Tobias Roth



Tobias Roth - der Spurenleger
Der 1985 in München geborene Schriftsteller, stellvertretende Vorsitzende der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, zugleich Doktorand an der Humboldt-Universität zu Berlin und dort wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich "Transformationen der Antike", erhielt im März 2013 zusammen mit Uljana Wolf im Rahmen des bedeutendsten Nachwuchswettbwerbs deutschsprachiger Lyrik den Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis. Sein erster Gedichtband "Aus Waben" erschien zeitgleich im Verlagshaus J. Frank. Wie er in unserem Gespräch am 23. Juli im Münchner MichaeliGarten verriet, schreibt Tobias Roth aber nicht nur Lyrik, sondern seit fünf Jahren auch an einem historischen Roman.
KK: Wenn Sie sich ein Bild ansehen, wird es in der Beschreibung kein Stillleben, kein Hineinkriechen ins Bild, sondern es strahlt auf Sie aus, und dann treten Sie Ihre eigene Reise an, so interpretiere ich das. Liege ich da falsch?
TR: Der Begriff der Reise ist mir in dieser Beziehung noch nicht untergekommen, aber es ist eigentlich ein schönes Bild, gerade im Kontrast zum traditionellen Wanderbild (lacht). Da gefällt mir die Reise sehr viel besser, weil die auch eine Rückkehr beinhaltet, und es nicht der romantische Gang auf die lyrische Walz ist: Mal schaun, ob man lebendig über den Brenner kommt. Wenn ich nach Rom fahre, um mir den Lorenzo Lotto anzusehen, dann bin ich natürlich sehr viel sicherer als jemand im 18. Jahrhundert, der nach Rom fährt, um sich vielleicht ebenfalls Lorenzo Lotto anzuschauen. Insofern würde ich Ihnen schon zustimmen. Das Setting und das Museum sind sehr viel statischer geworden und deswegen ist vielleicht der Reiseimpuls eher nach innen gerichtet; oder, wie zum Beispiel bei dem Lorenzo-Lotto-Gedicht "Ritratto di gentiluomo sulla terrazza" in eine Innerlichkeit und eine Projektion von Innerlichkeit aufgespalten.
KK: Aber Sie sind ja ein geerdeter Bayer, sozusagen von den Wurzeln her, auch Wanderer, Fahrradfahrer und so weiter, das heißt, Sie brauchen diese Gleise der Wirklichkeit des Zurück, oder? Auch die Korrespondenz zum Jetzt ist bei Ihnen in den Gedichten immer da. Sie verlieren sich da ja nicht im Mythos oder in der Antike oder Renaissance.
TR: Das will ich hoffen. Vielleicht ist das ein Teil der Faszinationskraft bildender Kunst auf mich, dass sie immer in Kürzeln spricht, also die Szenen einfängt und die Kürzel entwirft, die Alternativen eröffnet, aber immer sehr schnell rückbindbar bleibt auf ein Jetzt. Im Text funktioniert das natürlich einmal mehr, einmal weniger. Viel Geschriebenes findet nie mehr aus dem Notizbuch heraus. Ich beschreibe viel als Gedächtnisstütze, und plötzlich kann es auch als Gedicht interessant werden, wenn es ein Thema trifft, das hoffentlich nicht nur mich selber umtreibt. Dazu braucht’s ja schon ein bisschen mehr, und da braucht’s auch einen Gegenwartsbezug.
KK: Also, ich hab den Begriff der Reise mir ja … ausgedacht kann man nicht sagen, weil ich gemerkt habe, dass ein Dialog mit den Bildern entsteht, der dann zu einer Reise führt in dem, was Sie sehen. Aber der Ausgangspunkt ist im Grunde oft die Italienische Renaissance.
TR: Ja, diese unglaubliche Zeit um 1500, die hat mich in den letzten 2, 3 Jahren einfach zunehmend gefesselt. Jetzt fängt’s an zu regnen.
KK: Oh je.
TR: Das ist unerwartet.
KK: Das passt zu Ihnen (lacht), muss ich sagen.
TR: (lacht auch)
KK: Wie mit den Rissen in Mantua. Die Natur, die spielt bei Ihnen eine große Rolle. Wir gehen rein, nicht?
TR: Ja – jetzt wird’s zu viel.

Palazzo del Te in Mantua, Saal der Giganten

RITRATTO DI GENTILUOMO SULLA TERRAZZA
Lorenzo Lotto, 1533, 108cm x 101cm
Einige Blätter und Blüten Jasmin auf dem Tisch.
Die Landschaft klar wie Granatapfelfleisch.
Der Genuss muss nicht gerufen werden.
Gestützt auf einem Brief, die Hand grüßt leicht hinüber.
Durch Städte bin ich gegangen,
Nicht mehr und nicht weniger.
Da habe ich Menschen sehen können,
Frauen, als sie klassisch hießen.
Männer, die als erhaben galten,
In dem Moment, als sie es waren,
Ohne es zu wissen.
Ich dachte an Kinder und Greise,
Die zueinander aufblicken.
(Sein Weg geht an Landhäusern vorbei
Und an hängenden Gärten
Tief im Inneren einer Stadt,
Wo Zitronen vor die Füße fallen.)
Alte Säulen säumten meinen Weg.
Man sagt, ich hätte sie zu deuten gewusst,
Wie den frischen Mohn unter ihnen,
Aber ich sage auch nach der langen Arbeit,
Von der niemand wissen darf,
Ich habe sie nicht verstanden.
(Selbst mit einem Namen wird er
Sich nicht mehr beschweren wollen.
Vielleicht fliegen gerade Falken
Und Botschafter an ferne Türen,
Aber er achtet nicht darauf.)
Kurz bevor ich aufwache
Habe ich keine Erinnerung an mich;
Kurz bevor ich einschlafe
Vergesse ich alles von mir;
Vielleicht ist die Sehnsucht
Des einen nach dem anderen
Das Band, das mich zusammenhält.
(An den Schläfen entlang geflochtene Zöpfe
Und ein Sturzbach daneben:
Rispenbündel Weizen,
Dichte Kordeln Ruß.)
Ich sehe die Welt und ihr
Rohes Fleisch und verbrauche
Mich im Widerstand.
Ich kann Zeit vernichten,
Aber niemals Zeit vergessen.
(Er darf niemals müde sein.
Das ist sein Kreuz.)
Ich finde keine Form.
Die Frage ist nicht, was einst
Mit meinen Gütern geschehen wird.
(Er wird lächeln wie eine Sonne.
Ob du willst oder nicht,
Ob er es fühlt oder nicht.)
Tobias Roth: Aus Waben. Gedichte. Berlin (Verlagshaus
J. Frank) 2013. S. 50 f.
(Später, wieder am Biertisch)
KK: Das war ja jetzt eine gute Überleitung zu den Rissen. Ich hatte ja dieses Leitthema mit den Rissen angefangen, weil in Ihrem Langgedicht "Mantuanischer Riss" sozusagen aus den Rissen in der Mauer und in den Fresken, die gefesselten Naturgewalten oder Giganten sich unter Umständen wieder befreien und das Ganze richtig zerstören, so hab ich das verstanden.
TR: Es ist, wie soll ich sagen, dieses Bedrohungsmoment, das von den Rissen ausgeht. Aber es ist eine zweischneidige Angelegenheit, weil natürlich der Riss im Fresko insgesamt mehr über das Fresko erzählt als das Fresko selber, die ganze Geschichte. Da sehe ich eine Verbindung zur venezianischer Renaissance-Malerei, die ich mit ganzem Herzen liebe. Dort beginnt es, dass sich die Konturen auflösen. Das ist ja nochmal etwas anderes als Leonardos Sfumato, das wie ein van Eyck’scher naturalistischer Kniff wirkt. Gerade bei Giorgione und Tizian erscheint mir das schon als fertiges Statement: die aufgelöste Linie erzählt von der festen Linie und von ihrer Auflösung.
KK: Das ist beides mit drin.
TR: Ja, und das Fresko hat noch dazu immer die Zeitkomponente mit eingeschrieben, unwiederbringlich. Wenn der Putz trocken ist, dann ist es vorbei. Dann kannst du es wieder abklopfen. Das Fresko steht auch in der Landschaft, es ist gleichsam eine saisonale Angelegenheit ist. Im Hochsommer wird niemand ein Fresko malen, weil er dann noch weniger Zeit hat. Es ist immer angekoppelt an die Landschaft und die Bedingungen des Materials, und zwar ganz konkret und sehr im Moment – der Akt des Machens ist präsent. Der wird dann quasi komplementiert, durch den Nicht-Akt der Verwahrlosung, der Nachlässigkeit.
KK: Was reizt Sie denn jetzt speziell gerade an der italienischen Spät- oder Mittelrenaissance?
TR: Es sind mehrere Faktoren. Es ist einerseits diese Zeit vor dem Auftreten des Protestantismus, wo sich der Katholizismus ein Heidentum leisten kann, das ich in den folgenden Epochen des Christentums schmerzlich vermisse. Eine moralische Deregulierung scheint vertretbar, weil sich keiner versteifen muss in einem moralisch-theologischen Schützengraben, weil es keine Konkurrenten um das Heil gibt.
KK: Jaja, nun gut, das Heidentum von Denkern wie Ficino oder Pico della Mirandola und andere.
TR: Genau. Ein zweiter Punkt, den ich geistesgeschichtlich und auch als Schreiber wahnsinnig interessant finde, ist, dass Textkritik anfängt, dass ein Bewusstsein für die Materialität der Überlieferung einsetzt, die dann irgendwann meinetwegen zum Historizismus und unseren Universitäten führen wird. Petrarca mit seinem Livius etwa begreift, dass der Text ein Trägermaterial hat – und wenn wir herausfinden wollen, was da steht, müssen wir das mitbedenken, also einen Fassungsvergleich anstellen. Das Buch tritt als magischer Gegenstand in den Hintergrund, und der Buchdruck besiegelt diese Tendenz. Wenige Jahrzehnte später, also 1520/1530 in Venedig, ist das schon ausgereifte Industrie, und so wunderbare Sauhunde wie Pietro Aretino publizieren mit einer Nonchalance, dass es ein Fest ist. Das ist die Kombination, die ich an Italien immer spannender finde: dieses seltsame, quere Selbstbewusstsein, wir sind ja eigentlich die Söhne der Römer und das gehört uns alles. Zugleich wird es nie so dogmatisch und pedantisch wie zum Beispiel die deutsche Klassik oder auch Thorvaldsen, der ganze nordische Klassizismus (auch der Italiener Canova ist in diesem Sinne für mich Skandinave), behutsam und präzise, aber auch nie zum Scherz der Fälschung aufgelegt. Das hätte sich jeder Renaissance-Italiener, ohne mit der Wimper zu zucken, sofort zugetraut: einen Platon fertig zu schreiben, einen Catull zu lektorieren und mit Kopien Statuen zu ergänzen. Es hat etwas Spielerisches. Das ist so eine schöne Gemengelage, aus einem großen Respekt vor alter Kunst und aus einem ebenso großen Freiheits- und Neugiertrieb, das immer nach Selbstausdruck strebt. Das sind ja auch genau diese Jahre, in denen zum ersten Mal das Wort „sich ausdrücken“ reflexiv benutzt wird.
KK: Das gehört mit zur Renaissance, die Freiheit des Menschen und die Möglichkeit, dass der Mensch etwas Göttliches in sich hat?
TR: Ich würd jetzt nicht die großen Burckhardt’schen Formeln bemühen, die finde ich auch ein bisschen übertrieben, also die Entdeckung der Welt und die Entdeckung des Subjekts, das ist, glaub ich, ein bisschen zu optimistisch gelesen. Gerade bei den genannten, Ficino und Pico, das sind schon sehr geerdete Theologen, die ganz genau wissen, wo’s aufhört für den Menschen.
KK: … mythisch und insgesamt.

Nur ein kurzer Weg von der Stadt und von dem Palast, wo
Vorwärts die Risse sich fressen Unter den zarten Gesichtern,
Zwischen der Stadt und dem Stadion, Plötzlich ein zweiter
Palast von
Giulio Romano, Te, die Einstige Insel in Wiesen.
Fresken wuchern vom Boden Restlos bis unter die Decke:
Camera dei Giganti, Eines der fluchtenden Zimmer.
Dort ist nichts beschädigt. Taumel das Bild, das die Umwelt
Füllt (mit Hilfe Rinaldo Mantovanos, Ghisonis,
Luca Da Faenzas), Ohne spürbare Grenze,
Tat des geduldigen Risses. Den empörten Giganten
Bricht die Welt zusammen, Obdach, Körper und Landschaft.
Auseinandergedrehte Marmorstücke und Ziegel
Splittern entlang der Maserung, Allen Fugen zerbricht der
Mörtel und die Wände Neigen sich abwärts, die nur die
Farbe festhält; kaum ist sie Trocken, muss sie sie tragen.
Aus der Decke blicken auf Uns die schweigsamen Zuschauer.
Zeus hebt gerade seinen Arm, geradeaus rutscht die
Schwere auf unsere Scheitel, Nacht ertränkt unser Augen,
Alle Gelenke zerrissen, Ohne Regung die Zungen.
Stückweis fallen unter den Beben unsere Fresken,
Das wissen alle, es Ist nur Schrecken und Alltag.
Neben ihm die Blüten Sollten auf Zuneigung hoffen,
Wie wir.
(Letzte Strophe von Tobias Roth: Mantuanischer Riss, im Herbst 2013 abgedruckt von Sprache im technischen Zeitalter, Berlin.)

Pietro Aretino: I tre libri della humanità di Christo.
Venedig 1536.

Bertel Thorvaldsen, dem dänischen Bildhauer (1770-1849,
ist ein Museum in Kopenhagen gewidmet.
TR: Genau, das ist es mit Picos berühmter Rede über die Würde des Menschen. Das ist bei Weitem noch nicht der Camus’sche Sisyphos, der irgendwie glückselig ist in seinem Wahnsinn von Freiheit, sondern das steht ganz fix: unten sind die Tiere, oben sind die Engel, und dazwischen der Mensch – hier ist dein Spielraum. Und das finde ich eigentlich "anthropologisch" die richtigere Einschätzung, denn diese totale Freiheit, die mir zur Last wird – in die Situation möchte ich mal kommen, dass mir meine Freiheit tatsächlich zu viel wird (lacht). Und, was ich noch sagen möchte, was definitiv ganz wichtig für meine Renaissanceaffinität ist, sind viele, viele irrationale Gründe, sind einfach ästhetische Präferenzen, die ich mir selber auch gar nicht krampfhaft erklären will – das fing mit der Malerei an, und dann hab ich mich gefragt, was diese Maler denn lesen, und dann kam das Neuland. Renaissance gibt’s in diesem starken Sinne in Deutschland kaum, weil erst so spät eine deutschsprachige Literatur entsteht. Da taucht mal ein einzelnes "Narrenschiff" auf, aber das wird dann auch stracks ins Lateinische übersetzt. Deswegen wird’s auch nicht gelehrt und ist weitgehend unbekannt. Für mich war das ein Kulturschock von meiner eigenen Kultur. Und soweit ich momentan sehen kann, ist die Renaissance, gerade in Italien, der Ellenbogen zwischen der Vorvergangenheit und dieser mystischen Antike, die auch schön unscharf ist in ihrer Fassung, und dem Asphalt, auf dem wir herumlaufen. Der Witz ist schließlich, dass die Humanisten das sofort bemerkt und reflexiv behandelt haben.

Sebastian Brant: Das Narrenschiff, Titelseite.
KK: Das ist eine Pendeltür, sozusagen. Ich wollt jetzt in diesem Zusammenhang auf Ihr Schreiben eingehen. Sie können diese Seelentiefe Ihres Schreibens über Gedanken oder eine Gedankenreise erreichen. Wie läuft das dann? Über das Bild, das Sie sehen, das Ihnen etwas gibt, das Sie imprägniert? Oder läuft das eben über Inspiration, Eingebung?
TR: Hm. Also was mich dann länger festhält vor einem Bild, sind zumeist schon Wörter, die spontan auftauchen, da könnte man …
KK: Wörter? Ein Bild besteht doch nicht aus Wörtern.
TR: Ja, aber es löst Wörter in mir aus. Das kann schlicht und ergreifend aus einer Bildbeschreibung hervorgehen. Ich kenne viele Bilder, die eigentlich relativ unspektakulär aussehen, aber sobald man versucht zu benennen, was da angeordnet ist, wird es als Wortkombination höchst spektakulär, was da passiert.
KK: Und sind das Wortimpulse oder Gedanken, die Ihnen dann kommen?
TR: Das ist schwer zu unterscheiden, und zugleich es ist mir schon bewusst, dass ich gerade mit meiner Lesetätigkeit sehr vorbelastet an Malerei herantrete und sich leicht Kurzschlüsse zu Konzepten ergeben, die ich interessant finde. Wie zum Beispiel bei diesem Portrait von Lorenzo Lotto, wo ich sofort den Hofmann sehe, und das ganz schöne Buch von Castiglione als Echo im Kopf habe: die Frage, was soll eigentlich ein Hofmann sein? Wie stellen wir uns den idealen Menschen vor, der den Herrscher obsolet macht?
KK: Naja, Platon nennt das ja Erinnerung, also eine Quelle, die in Ihnen ist, die Ihnen, wenn sich etwas öffnet, ein Erinnerungsbild gibt, das Sie weiterspinnen können. Schreiben Sie sozusagen Wort für Wort und in einem halb meditativen Zustand, oder schreiben Sie mit einer Art Zettelkasten?
TR: Ich habe keinen Zettelkasten, das bereu ich oft. Ich bin nach wie vor zu schlampig, um einen anzufangen. Es ist momentan noch das Notizbuch, das in der Sakkotasche steckt. Aber wenn ich sehe, das und das Bild, da ist Potenzial für eine sprachliche Fassung, dann erlaube ich mir durchaus diesen völlig unzeitgemäßen Luxus, mich eine ganze Stunde davorzusetzen, um zu sehen, was passiert. Das ist übrigens bei Texten, die mich anregen, ganz der gleiche Fall.
KK: Ah, Sie setzen sich nachträglich dann nochmal vor das Bild?
TR: Ja.
KK: Als Foto oder …
TR: Nein, nein. Ich geh dann eben nochmal ins Museum. Wie Anselm Feuerbach, glaube ich, sehr schön gesagt hat: Was gehört zum Verständnis eines Bildes? Ein Stuhl.
KK: (lacht)
TR: Ich bin ja aufgewachsen mit 24 Bildern pro Sekunde. Es ist schon sehr, sehr erstaunlich und – kathartisch will ich nicht sagen – aber man merkt, dass diese Bilder dafür gemacht sind, über Stunden hinweg Menschen zu fesseln und zu unterhalten. Sie verändern sich beständig, und das ist dann auch genau der Moment, in dem zum Beispiel narrative Züge in eine Bildbeschreibung kommen können.
KK: Aber die verändern sich nur, weil Sie korrespondieren mit dem Bild.
TR: Nicht nur.
KK: Aber es fängt an zu arbeiten.

Das von Raffael gemalte Portrait des Baldassare Castiglione (1478 - 1529) , der als Diplomat über die Lebensart des Höflings (Der Hofmann. Berlin (Wagenbach) 1999) geschrieben hat.
TR: Ja, genau. Beispielsweise das Cariani-Bild mit der bukolischen Disposition ("Ritratto di donna nel paesaggio"). Auf den ersten Blick sieht man nur die halbnackte Frau in der Landschaft, ja, das sind diese Schäfer, die sich gegenseitig ihre Liebe klagen, aber wenn man dem Bild mehr Zeit gibt, dann merkt man: Da brennen im Hintergrund Städte, da wird Politik verhandelt, plötzlich ist es eine politische Aussage, dass diese Schäfer überhaupt über Liebe reden. Diese Allmählichkeit ist auch eine Aussage über den Betrachter, man muss sich von manchen Bildern schon einiges gefallen lassen. Es ist schwer, diesen Zirkelschluss einschlägig aufzudröseln, aber da merke ich jedes Mal, dass die Zeit, die man gibt, mit großem Gewinn zur Erzählung wird. Je mehr dieser Bilder ich sehe, und je mehr dieser Gedichte ich lese, desto schöner wird’s.
KK: Die Erweckung der Einbildungskraft wächst dadurch, dass Sie sich hinein versenken. Ist das nun mehr in einem Panoramablick, oder geht das mehr, wie etwa bei Kiefer, in die Schraffuren und Strukturen?
TR: Es ist schon das Detail. Ich bin in diesem Sinne, um es renaissantisch zu sagen, eher Venezianer als Florentiner – mir geht’s um die Materialität und die Farbe, die Leuchtkraft, und nicht so sehr um korrekte Gruppierung, die Idea, das Disegno, die da dahintersteht; was mich fasziniert, ist schon die Oberfläche. Es ist der Stil, und nicht so sehr der Inhalt, der mich dann fesselt. Gerade die Malerei der Renaissance ist da sehr entspannt. Maria mit Kind, alles klar, alle wissen Bescheid. Es geht jetzt nur noch darum, wie sie aussieht, wie der Stoff leuchtet, wie die Landschaft im Hintergrund sich öffnet. Wie sind die Details angeordnet?

Giovanni Cariani: Ruhende junge Frau mit weißem Schoßhund in einer Landschaft (zwischen 1520 - 1522). Gemäldegalerie Berlin.
KK: Und da ist ja auch diese Trennung, da ist auch der Ansatz Ihrer Lyrik, die Trennung zu manchen anderen, weil die Vormodernen, also sagen wir mal Degas, scheinbar altmodisch gemalt haben, aber im Detail …
TR: Genau. Oder die Art und Weise, wie man die Augen malt, also man denkt sich, hier Manet, bourgeoises Setting, nichts passiert, und plötzlich merkt man: alles ist anders.
KK: Und da liegt es eben daran, dass Farben etwas auslösen können, wie Worte, Wortfarben gibt’s ja auch …
TR: Unbedingt, ich schätze auch die musikalische Metapher der Klangfarbe ungemein. Wenn ich über Musik schreibe, erstaune ich oft, wie schnell ich abdrifte in ein wirklich malerisches Vokabular. Aber um bei dieser Gleichsetzung von Metapher und Oberfläche und Farbe zu bleiben, können meine Gedichte auf der Oberfläche sehr viel älter scheinen als die frühe Moderne, Mallarmé oder Rimbaud und so weiter. Es ist natürlich die Frage, wo man hinschaut. Ich schätze einfach den ganzen Satz. Das ist mir erst recht spät im Umfang klargeworden, was das heute für ein aggressiv-ästhetischer Gestus ist. Denn was mich zunehmend stört, ist, dass die galoppierende Abstrahierung des Stils auch bereits ihre hundert Jahre auf dem Buckel hat und nicht aufhört, sich als neu zu bezeichnen. Die Destruktions-Ästhetiken laufen weiter, ohne dass man sich die einschneidende Frage tatsächlich stellen würde: Was machen wir eigentlich nach dem Dadaismus? Denn der ist wirklich eine Meisterkonzeptkunst, die sehr streng ist, auch mit ihren Nachkommen. Am Ende geht es nur noch um den Künstler selbst.
KK: Die Avantgarde versucht sich ja meiner Meinung nach zurzeit dem Barock zu nähern, in meinen Augen deswegen, weil das so weit weg ist und das Inhaltliche keine Rolle spielen muss, es eher ein Nachdichtungsexperiment wird. Was sagen Sie dazu?
TR: Ich find’s sehr einschlägig und geradezu lustig, dass sich beispielsweise ein Georg Philipp Harsdörffer liest wie ein Ernst Jandl, also dass da die gleichen Experimente wieder durchgespielt werden. Viele dieser avantgardistischen Isms sind mir zu rigide. Avantgarde ist ja nicht umsonst ein militärischer Begriff. Ist auch schon wieder fünfhundert Jahre her. Der Erfinder der Avantgarde war Giovanni de Medici dalle Bande Nere, der die Vorhut als militärisches Konzept etabliert hat.
"So geht er, läuft und sucht. Was sucht er? Ganz gewiss: dieser Mann, wie ich ihn dargestellt habe, dieser Einsiedler, der mit einer tätigen Imagination begabt ist, der immer durch "die große Menschenwüste" reist, hat ein höheres Ziel als ein reiner Müßiggänger, ein anderes, umfassenderes Ziel, als das flüchtige Pläsier des Augenblicks. Er sucht jenes Etwas, das ich mit Verlaub als die "Modernität" bezeichnen will; denn es bietet sich kein besseres Wort, um die in Rede stehende Idee auszudrücken.
Es handelt sich für ihn darum, von der Mode das loszulösen, was sie im Geschichtlichen an Poetischem, im Flüchtigen an Ewigem enthalten mag. (...) Die Modernität ist das Vorübergehende, das Entschwindende, das Zufällige, ist die Hälfte der Kunst, deren andere Hälfte das Ewige und Unabänderliche ist. Es hat eine Modernität für jeden alten Maler gegeben; die meisten Portraits, die aus früheren Zeiten auf uns gekommen sind, zeigen die Kostüme ihrer Zeit. Sie sind vollkommen harmonisch, weil das Kostüm, die Haartracht und selbst die Geste, der Blick und das Lächeln - denn jede Epoche hat ihre Haltung, ihren Blick und ihr Lächeln - ein Ganzes von vollkommener Lebensfülle bilden. Dieses sich wandelnde, flüchtige Element, dessen Metamorphosen so häufig sind, hat niemand das Recht zu verachten oder unbeachtet zu lassen. Wer es unterdrückt, fällt notgedrungen in das Vakuum einer Schönheit, die abstrakt und undefinierbar wäre wie die des einzigen Weibes vor dem Sündenfalle."
(Charles Baudelaire: Der Maler des modernen Lebens
(oder: Das Schöne, die Mode und das Glück), Abschnitt 3:
Die Modernität.)
KK: Jaja. Die andern müssen dann nach.
TR: Genau.
KK: Oder sie gehen wieder zurück.
TR: Oder sie sterben alle. (Lacht). Aber – eben, da fokussiert sich alles. Da frieren die Referenz und der Traditionsbezug in einem Punkt fest, in einem Manifest oder ähnlichem. Die Dadaisten haben schöne Manifeste geschrieben. "Gegen dieses Manifest sein, heißt Dadaist sein!" schließt das "Dadaistische Manifest". So geht das. Ansonsten finde ich stehende Befehle sehr unsympathisch, weil dann vergessen wird, mit zu reflektieren, wie die Vergangenheit, auf die ich mich beziehe, ihre eigene Vergangenheit reflektiert hat, und dadurch wird eine Dimension gekappt, die die Sprache hat und die Lyrik im Speziellen freisetzen kann. Lyrik hat ja in der Art und Weise, in der sie mit Sprache umgeht, und vor allem auch in der Art und Weise, wie sie gelesen wird, unglaubliche Möglichkeiten, durch minimalsten Aufwand riesige Zeiträume und Themenfelder aufzumachen. Zu denen muss sie sich dann aber auch verhalten. Dieser zeitgenössische Kunstjargon von wegen xy interessiert mich und yz finde ich spannend und x thematisiert z, Sie kennen das von Museumsschildern zur Genüge – ja, wieso interessiert er sich denn dafür? Und wie thematisiert er’s denn? Was will er denn damit? In der Dichtung erstreckt sich das bis ins Formale und die scheinbar so wilde freie Form wird plötzlich aalglatt. Ein Versteckspiel hinter der offenen Form, wenn ich freie Verse schreibe, dann kann mir keiner sagen, du hast es falsch gemacht. Diese Tarnkappe nehme ich auch oft in Anspruch, aber es ist schon seltsam. Dem gegenüber steht der bestimmte Formwillen, diese fixe Idee, dass zu diesem und jenem Gedicht eben dieser und jener Vers gehört, der älter ist als ich, weil es zum Text gehört, dass er älter ist als ich. Dann kann man mir mit Recht sagen, schön, aber da fehlt eine Silbe, und das ist schlichtweg falsch. Wenn die Abweichung keinen lyrischen Mehrwert erzeugt, ist es tatsächlich ein Fehler. Sobald ich sage "Experiment", kann ich solche Vorwürfe von mir abperlen lassen, aber das ist schon ein ziemliches Wiegenlied. Denn unterm Strich, ob man nun eine handwerkliche Komponente rauskürzt oder nicht, muss immer gelten fuori le palle, sprich: raus mit den Eiern.
Die Teutsche Sprache hat sich mit den andern Haubtsprachen um den Vorsitz gezancket / und ihre Verachtung mit nachgehender Schutzrede abgelehnet.
Ich / sagte sie / biete euch allen den Trutz / ob eine ist / die mit mir der Natur so deutlich nachsprechen / und alles das / was einen Laut von sich giebet / so eigentlich und vernemlich ausdrucken kan. Ich brülle wie der Löw / ich bölcke wie der Ochs / ich brumme wie der Beer / ich blecke wie das Schaf / ich gruntze wie das Schwein / ich baffe wie der Hund / ich zische wie die Schlange / ich rintsche wie das Pferd / ich maue wie die Katze / ich schnattre wie die Gans / quacke wie die Endte / kackle und klucke wie das Hun / schnattre und klappere wie der Storch / swiere wie die Schwalbe / kracke wie der Rab / silcke wie der Sperling / u. Ich prassle und schlürffe mit dem Wasser / lisple und wisple mit den Bächen / summe und brumme mit den Immen / rolle und rülle mit dem Donner / erschütter und zersplitter / zerscheidre die Schiffe / ich schmiege und biege / spratzle wie das brennende Holtz / knirsche wie das Messer auf dem Marmol / und bilde also alles Getön / das gehöret werden kan. Die andren Sprachen müheten sich ihr nachzureden / konten aber nicht weit kommen / und mussten der Teutschen Sprache den Vortritt überlassen."
(Georg Philipp Harsdörffer: Die Teutsche Sprache.
Erstdruck 1651.)
KK: Nun wollte ich noch kurz auf das Dionysische zu sprechen kommen. Sie sind ja ein sinnlicher Mensch, bayrisch-sinnlicher Mensch, mit Dolomitenwanderungen, und was weiß ich nicht alles, und ziehen, wie ich glaube, sehr viel Kraft, aus den – sagen wir mal – Elementen, aus Bäumen, Erde, dem Gebirge und dem Wasser, den Wolken.
TR: Unbedingt.
KK: Dieses dionysische Prinzip, das haben Sie ja studiert, auch wahrscheinlich durch die Antike – beziehen Sie es auf die Naturgewalten?
TR: Auch, aber in erster Linie sind es für mich zwischenmenschliche Gewalten, die erscheinen mir oft ebenso unvorhersehbar und mathematisch erhaben wie ein Gebirge. Wenn ich zum Dionysischen Stellung nehmen soll, dann als Überwältigung meiner Person, durch Rausch, durch Elemente, durch Sex. Das ist in mir als Körper, das greift schon anders ein als Bilderanschauen, auf alle Fälle. Aber es ist nicht klar zu unterscheiden – man kann kaum "Dionysisch" ohne "Apollinisch" sagen, aber ich sehe diese Trennung nicht deutlich. Nicht einmal in den Figuren des Dionysos oder Apollon. Die Unschärfe der Trennung fasziniert mich zum Beispiel gerade bei Bergen und Bäumen. Kein Berg ohne seine Aussicht: nur dass der Blick in die Landschaft nicht der Blick in die Natur ist, sondern den Betrachter miteinbegreift. Genauso ist der Baum nicht nur der Baum, sondern hat immer, sobald ich ihn aufschreibe, einen riesigen Rattenschwanz an – also ab dem Physiologos – Zuschreibungen, Bedeutungen. Was ist denn eigentlich dieser Baum? Und man kann in diesem Sinn keinen "unschuldigen" Baum beschreiben, die haben immer Bedeutung mit dabei; ob das jetzt der zeitgenössische Leser sieht oder nicht, macht da keinen Unterschied.
KK: Also der Wein und die Sexualität, das ist zu vielschichtig, um darüber jetzt zu reden. Aber diese Energie, die da in Ihnen ausgelöst wird, führt, das ist mir im Gespräch aufgefallen, auch immer zurück. Wobei das Physische bei Ihnen eine große Rolle spielt – und das ist ja auch das wirklich Gute in Ihren Gedichten, dass sie physisch auch greifen.
TR: Das freut mich natürlich sehr. Ich würde naturgemäß nie ein Manifest schreiben, aber es ist schon ein sehr starker Ausdruckswille, gerade in „Aus Waben“, dass das sinnliche, überwältigende Erleben thematisch entgrenzt ist; ausgehend naturgemäß von meinem persönlichen Erleben. Quer zu den Vorurteilen, was wie sagbar ist. Quasi: Du hast dich in ein Mädchen verliebt und mit ihr geschlafen, das ist dein persönliches Erleben, jetzt darfst du ein Erlebnisgedicht darüber schreiben. Aber wenn du ins Museum gehst, ist das eine bildungsbürgerliche Fleißaufgabe, das ist kein hochpersönliches Erleben, über das du dann mit sinnlicher Überwältigung schreiben kannst. (Lacht) Es ist mir sehr wichtig, das wieder anzunähern, diese Blockade nicht zu akzeptieren. Aber das sind, glaube ich, eher Orthodoxien des Schreibens und nicht so sehr des Denkens oder Lesens außerhalb der lyrischen Kaste. Wenn man es runterschraubt, dann ist man beim Urlaubsfotoklischee: ein Pärchen umarmt sich vor einer halbzerbröckelten Tempelruine in phänomenaler Landschaft, Italienurlaub 1950-2013, "das Wetter ist gut und das Essen schmeckt lecker". Ich könnte da nicht stehen bleiben, da sind meine Reizschwellen zu überzüchtet, aber gerade in solchen Szenen könnte man schon einen breiten Konsens annehmen, dass das Erleben einer kulturellen Vergangenheit, eines Naturraums und eines Selbst eine Einheit bilden, die große Kraft entfaltet.

Dionysos im Rebenschiff. Athener Augenschale
um 530 v. Chr.

Sparagmos des Pentheus. Deckel einer Vasenschüssel,
um 450 v. Chr. Louvre
Schlern und Langkofel sind die Bänke, auf denen sie sich in
Stücke reißen und speisen, über die Stacheln gebrochen
Wirbel, Kiefer, wenn Augen erblinden. Gebirgsstock der Erde.
Jeder Berg bedeutet mit ungemäßigter Stirn den
Eingeborenen Wahnsinn. Keine Landschaft für Menschen.
(Erste Strophe Tobias Roth: Sparagmos Lagazuoi.
Aus Waben, S. 27.)
KK: Das wäre also der Sparagmos, dieses Zerrissenwerden vom Wolkenbruch hin zur Sexualität und so weiter, wo etwas aufleuchtet und dann vorbei ist oder zerstört wird. Zurück zur Normalsituation.
TR: Hm.
KK: Da kommen wir jetzt zur Tyché. Je weiter es geht, desto mehr sind Gefahren damit verbunden.
TR: Ja.
KK: Leukothea und Tyché. Irgendwie wird das Dionysische immer begleitet von der Hoffnung, dass man das Licht und das Weiße erleben kann – aber Leukothea selber ist zunächst von den Klippen gesprungen und erstmal gestorben.
TR: Naja, ihr Mann ist wahnsinnig geworden und hat sie verfolgt, weil sie den jungen Dionysos als Ziehkind …
KK: Sie hat was gesehen, was sie nicht sehen durfte, nicht wahr?
TR: Zum Beispiel.
KK: Sie musste erstmal die Katharsis, die Reinigung, durchleben, die unter Umständen auch sehr hart ist. Und dann ist sie eine Halbgöttin oder sowas geworden, also aufgefangen worden. Ah, jetzt hab ich das alles beantwortet statt Sie!
TR: (lacht) Gut, das Dionysische ist ein Granatapfel mit mehr als einem Kern. Aber ich denke schon, dass man im Moment der großen Überwältigung, hin bis zum Selbstverlust, angewiesen ist auf Instanzen, die einen beschützen.
KK: Und wer soll das sein?
TR: Das ist ja die Frage. In "Daunen und Firn" wird sie abschlägig beantwortet, das weiche Weiße ist abgelöst von gleichsam betonierter Geometrie. Und im Tyche-Gedicht "Mauerkränze" vollzieht der Text selbst die Suchbewegung, das Pendel schlägt von den selbstbewussten Dioden des Werktagslebens bis hin zum Votiv-Hexameter, der einfach nur Gebet ist: "Lass unsere Wege sicher sein und weithin zu sehen."
KK: Gut. Vergils Hirtengedichte –wir sind ja jetzt bei „Aus Waben“.
TR: Ja, aus Waben.
KK: Die Bienen spielen sozusagen als Eingeweihte für die Tradition und als Arbeitstiere eine große Rolle, weil sie die Essenzen, den Honig sammeln und weitertragen.
TR: Das ist das Bild der fleißigen Biene und der staatsbildenden Biene.
KK: Wobei der Honig für die Antike nicht nur die Süße, sondern auch das Erstickende, den Tod bedeutet, also Gefahr ist allemal da.
TR: Mein Verständnis von der Biene als poetologische Großmetapher hat eigentlich zwei zentrale Punkte. Das ist einmal der Aspekt der Vielfalt, also dass die Biene zu vielen verschiedenen Blüten geht, und einen eigenen Magen dafür hat, wiederkäut. Für diese Vielfalt und interne Zirkulation kenne ich kein schöneres Bild. Auf der anderen Seite steht, dass die Biene immer durch einen einzelnen Tag fliegt, also im Sammelvorgang immer sehr gegenwärtig und sehr gebunden ist an ihrem aktuellen Zeitpunkt, aber zu Pflanzen fliegt, die tendenziell älter sind wie sie, also gerade die Biene, die zu Bäumen fliegt (lacht).
KK: Ja, nun sind die Waben sechseckig. Sie sind etwas sehr Stabiles, wenigstens, sagen wir mal, materiell Stabiles. Es heißt ja „Aus“ Waben, Sie ziehen sozusagen Material, was noch da ist, aus diesem Stabilen heraus.
TR: Und andererseits besteht auch der Band aus „Waben“, es werden wieder neue Waben angelegt.
KK: Ist ja ein Teppich, diese Wabenanordnung.
TR: Genau.
Tyché, die griechische Göttin des Schicksals, der guten wie bösen Fügung, auch des "Zufalls" in diesem Sinn. Launenhaft erhöht und erniedrigt sie - ist Tochter des Zeus mit den Attributen: Füllhorn, Ruder, Flügel. Bisweilen hat sie auch den Knabengott Plutos (Reichtum) im Arm.
Tobias Roth bezieht sich auf sie in dem Gedicht "Mauerkränze", worin es heißt:
"Das Kartenhaus: sein Wanken zerschlägt den Tag,
Begräbt mich unter sich, macht mein Blut so dick,
Und selbst mein Flüstern in vertraute
Ohren wird durch dich vielleicht verändert."
Daunen und Firn
Da wandelt auf unruhigen Feldern
Leukothea, Amme des Rausches einst, jetzt
Liguster und Jasmin, keine Hilfe mehr.
Wenn der Wind in alles Wellen kämmt
Und der Himmel
Nicht einen Moment
Der gleich ist.
So wenig, klagt sie über uns,
Raum, um weich zu sein.
Lichtpunkte auf den
Weißen Haaren des Meeres,
Auf vergletscherten Graten,
Zittern des Zitterns.
Doch man schmiegt sich in die
Letzten Winkel und Ecken.
Die letzte klare Form
Im Dünnschliff des Turmalins,
Die als Wunde des Sündenbocks
Wie in Kirchenfenstern
Brennt und blüht;
Wir hoffen, es war der letzte
Und den Lämmern langes Leben:
Die uns verweisen,
Die wir vergleichen:
Unsere stete Nähe zu,
Unsere stete Sehnsucht nach
Daunen und Firn.
Unter ausgeblühten Bäumen,
Zwischen weißen Dolden,
Durch die schräg der Wind geht.
(Tobias Roth: Aus Waben. Gedichte. Berlin (Verlagshaus
J. Frank) 2013, S. 9.)
KK: Sie beschreiben, wie er aufreißt, und denken darüber nach, was ist, wenn er aufreißt, von dort kommen die Erlebnisse. So ein bisschen in dieser Max Ernst’schen Art des Hineintauchens in das Gewebe, die Strukturen, auch in die Risse?
TR: Also mit dieser Gewebe-Metapher ist natürlich die Hoffnung auf den Einlegefaden verbunden, jener Faden, der nicht aus edlerem Material ist, aber der im Gewebe ein Muster bildet.
KK: Der Einschlagfaden, ein frühchristliches Motiv.
TR: Ja. Ein sehr schönes Motiv, finde ich.
KK: Das setzt aber den Logos voraus.
TR: Naja.
KK: Nun habe ich noch einen Vers aus Ihrem Buch aufgegriffen: „ich fürchte meine Ungenauigkeiten“ – Haben Sie das Gefühl, dass Sie die Natur innerlich verlassen, oder einfach zu wenig wissen, bzw. zu ungenau sprechen oder nicht die exakten Worte finden?
TR: Das spielt ineinander. Die Frage ist, ob ich das denn wirklich nicht nur aufschreiben, sondern auch weiter ausleben und transportieren kann. Das ist natürlich eine große Unsicherheit. Und also definitiv ein Quell der Furcht im Sinne des Teilens – das ist doch ein großer Antrieb des Schreibens, Dinge teilen zu wollen. Ich will in ein Medium übersetzen, das Streuung erlaubt. Die Reibungsverluste haben wohl die Überhand und die Frage bleibt, ob ich überhaupt das teile, was ich teilen möchte. Zudem sich das, was ich teilen möchte, viel mit dem Unterwegs- und Woanders-Sein entwickelt hat. Ich habe sehr viel Zeit in Italien verbracht, de facto und im Kopf, das verändert den Blick. Dieser leicht angeschrägte Blick ist unfassbar fruchtbar, wenn man eine grobe Vorstellung hat, wo die Schräge anfängt und wo sie aufhört – wenn man also nicht vergisst, sich selber zu beobachten, während man in den Ruinen und Museen mit Schwelgen beschäftigt ist.
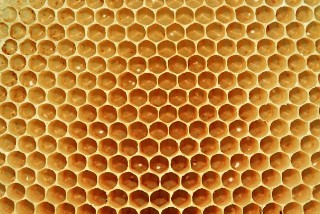
Sechseckigkeit der Bienenwaben.
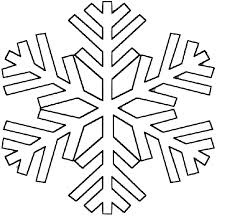
Sechseckigkeit der Schneeflocke.
Zu ihrer Kristallographie zuerst Johannes Kepler:
Strena seu de nive sexangula
Vom sechseckigen Schnee. Dresden (Hellerau-Verlag) 2005.
___________________________


