Philippe Jaccottet: Gedanken unter den Wolken
Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen
Timo Brandt
Bei Licht
„In einem der letzten Sommer, erinnere ich mich, als ich wieder einmal über Land wanderte, ist, so wie den Himmel zuweilen ein Vogel durcheilt, dem man weder erwartet noch gleich erkennt, mir das Wort Freude durch den Sinn gegangen und versetzte mich in das gleiche Staunen.“
Der hier
veröffentlichte Zyklus (im französischen Original Pensées sous les nuages) erschien bereits 1983. Bisher lag aber
keine deutsche Gesamtübersetzung vor, nur Teile waren in Sammlungen erschienen
oder in Zeitschriften abgedruckt worden. Nun erscheint der Zyklus zum ersten
Mal in der Originalzusammensetzung.
Im Werk des auf Französisch schreibenden Schweizer Dichters Philippe Jaccottet nimmt Pensées sous les nuages insofern eine Sonderstellung ein, weil es sein letztes Buch war, das ausschließlich Gedichte enthielt. In allen folgenden Bänden verschmelzen Prosa und Lyrik miteinander, vermischen sich bis zur Unkenntlichkeit und es gibt sehr viele aphoristische und reflexive Tendenzen.
Jaccottets Werke sind, dies will ich vorausschicken, eine Lektüre, die ich jedem nur empfehlen kann. Es ist eine überaus filigrane Poesie, in der eine tiefe Ruhe liegt, aber auch etwas Atemberaubendes. Das gilt auch für „Gedanken unter den Wolken“.
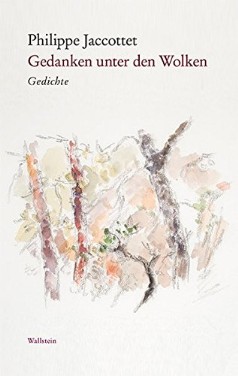
„So viele Jahreund wahrhaft so dürftiges Wissenso schnell versagendes Herz?[…]Die Seele, so fröstelnd, so furchtsam,muss sie denn endlos über den Gletscher wandern,barfuß, allein, und vergessen sogardas stotternde Gebet der Kindheit,für ihre Kälte endlos bestraft durch die Kälte?“
Zunächst scheint es, als habe man es hier mit langsamen, geradezu sparsamen Zyklen zu tun, mit einem flüchtigkeitsgetränkten Einlassen auf dieses und jenes, einer Dichtung der kleinen Schritte. Manchmal sind zehn oder zwanzig Verse, nicht selten ist aber nur ein Vierzeiler auf einer Seite abgedruckt – wie Wolken ziehen die Strophen in Gruppen oder allein über das Weiß des Papiers.
Bald tritt der Eindruck der Flüchtigkeit zurück hinter ein Gefühl von Weite. Eine Weite, deren Wesen sich vielleicht am besten mit jenen Versen von Tomas Tranströmer (aus einem Gedicht über Vermeer) bezeichnen lässt, wo es heißt:
„[Sie] ist wie ein Gebet zur Leere.Und die Leere kehrt uns ihr Gesicht zuund flüstert:»Ich bin nicht leer. Ich bin offen.«“
Lügt die Weite? Diese Frage wird u.a. in Jaccottets Gedichten verhandelt. Verspricht die Weite uns Möglichkeiten, oder ist sie Inbegriff unseres Scheiterns, Sinnbild für die Leere, die wir nie füllen können, in der wir nie genug fühlen können, egal wie viel wir zusammentragen? Ist die Weite des Himmels, des Universums, durchquert von Wolken, unseren Gedanken, schön oder grausam, tröstlich oder erschreckend?
„Dies Spätsommerlicht,wäre es bloß Schatten eines anderen,blendenden,ich wäre wohl nicht so erstaunt.“
Ein anderes wichtiges Phänomen ist das Licht. Das Licht, stets hinter den Wolken präsent, zwischen ihnen hervorscheinend, Quell des Himmels. Das Licht, das Leben verspricht, Wärme, und das die Dinge hervorbringt, erkennbar macht.
In Jaccottets Versen kann man ganz unterschiedliche Lichtverhältnisse beobachten, ganz unterschiedliche Bedeutungen von Licht: als Metapher für Jugend, als Metapher für Glaubwürdigkeit oder Fragwürdigkeit, als Sinnbild des Erkennens, als Blendung, als Idee von Wärme, als Zeichen von Kälte.
„dies herrlichste Licht auf den Felsen,vorn auf der Stirn die flammende Scheibe,die unsere Augen blendet,wenn es, wie‘s scheint, keine Macht über die Tränen,wie sollen wir es dann noch immer lieben?“
Schön, dass es eben nicht routinierte Zärtlichkeiten sind, die uns in Jaccottets Gedichten ansprechen und umtreiben, sondern Überlegungen, Fragen, feinsinnige Bemerkungen, kurze Betrachtungen, kleine Vorstellungen. Jaccottet streicht die Welt nicht glatt, sondern wirft ihre Erscheinungen auf, all das Blendende, Fröstelnde, Dunkelnde.
Es soll nichts fixiert werden, sondern das Geschehen wird als Geste gesehen, als Bewegung und Ablauf, kommend und gehend.
„Denk, was wär für dein Ohr,du, der du lauschst, hinaus in die Nacht,ein ganz sachter Schneefallvon Kristall.“
In dieser Welt, die sich endlos ausbreitet, nirgendwo endet, und doch innerhalb von Grenzen existiert, anhand derer sie schon wieder hinterfragt werden kann (und diese Grenzen können schon unsere Wahrnehmung sein, spätestens aber unsere Auslegung), zeigen diese Gedichte beides: eine lebendige Weltschau und ein Nachzeichnen der Grenzen.
„Hab denn ich ihn erfunden, den Abendlicht-Pinsel,auf der rauen Leinwand der Erde,das goldene Öl des Abends auf Wiesen und Wäldern?“
Ich kann nur empfehlen, Jaccottet für sich zu entdecken. Gedanken unter Wolken ist vermutlich ein guter Einstieg ins Werk, wobei die neueren Prosapoesiehybriden auch sehr reizvoll sind (Beispielsweise Antworten am Wegrand). Man merkt seinen Werken an, dass sie sich aus manchen Welten und Poetiken speisen (als Übersetzer hat Jaccottet sowohl die Odyssee Homers, als auch Rilkes Duineser Elegien, Hölderlins Hyperion und Musils Mann ohne Eigenschaften übersetzt), aber sie haben letztlich eine bemerkenswerte, feine und mannigfaltig leuchtende Eigenwilligkeit, die ich persönlich immer wieder sehr genieße.
„„Sieh, wie nunjede Musik von einst in seine Augen steigtals wilde Tränen:[…]Sonne, endlich nicht mehr so schüchtern, steigende Sonne,verlöt‘ mir dies Herz.Licht, du wölbst dich, hebst den Schatten,schüttelst den Frost von deinen Schultern,nie wollt ich anders als dich verstehen und dir gehorchen.“
Philippe Jaccottet: Gedanken unter den Wolken. Gedichte. Übersetzt von Elisabeth Edl und Wolfgang Matz. Göttingen (Wallstein Verlag) 2018. 126 Seiten. 20,00 Euro.


