Peter Sipos: Klumpen 1
Rezensionen/Lesetipp > Rückschau
0
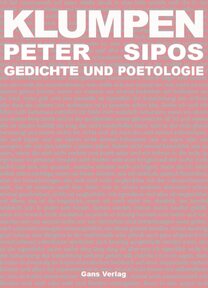
Florian Birnmeyer
Peter Sipos: Klumpen. Poetologie als
Selbstbefragung
Peter Sipos, 1998 in Bayern
geboren, tritt mit Klumpen (Gans Verlag, 2023) als eine der
markanteren Stimmen einer jüngeren Lyrikszene hervor, die das Verhältnis von
Innerlichkeit, Religion und Sprache neu vermisst. Mit Klumpen (Gans Verlag) legt er einen Gedichtband
vor, der gefolgt wurde von Klumpen 2 (Gans Verlag, 2024) und im Oktober
2025 Klumpen 3. Es scheint also, der Zyklus wird im jährlichen Abstand
erweitert. Der Untertitel des ersten Bandes, „Gedichte und Poetologie“,
verweist auf eine doppelte Ausrichtung.
Das
rosafarbene Cover mit violetter Kleinbuchstaben-Typografie des ersten Bandes deutet
das poetische Verfahren bereits an: feine Ironie, textuelle Überlagerung,
formale Versuche mit eigener ästhetischer Zielsetzung. Das Visuelle ist dabei kein
bloßes Beiwerk, sondern Teil jenes Ich-Netzes, das im Band, insbesondere in der
Poetologie, benannt wird und zum Motiv avanciert.
Der Band gliedert sich in
vier Kapitel:
1. (Skizzen) Klumpen2. (Nachtgesang) Schsch3. (Collage) Klagen4. (Poetologie) Das Ichnetz
Mehr noch als im zweiten Band öffnet sich Klumpen
für eine Dichtung, die das Persönliche und Spirituell-Religiöse ins Zentrum
rückt – eine Hinwendung zur Innerlichkeit. Die Gedichte schaffen eine Nähe, die
nicht naiv wirkt, sondern poetisch reflektiert ist. Wer hier mangelnde Distanz
oder fehlende Literarizität vermutet, verkennt den literarischen Anspruch der
lyrischen Sprache und die durchweg souveräne formale Gestaltung. Sipos
überführt das Persönliche in eine poetische Form, die es zugleich befragt und
über sich hinaushebt.
Bereits
das erste Kapitel enthält Formen von Gebet, wobei das lyrische Ich sich selbst
als eine Form von Prophet oder Seher sieht, der durch seine Dichtung zu wirken
beginnt:
ich bin ein prophet obwohl niemand einen propheten gesehen hat bin ich ein prophetund die leute sehen mich und sehen keinen propheten aber ich bin ein prophet
Es
gibt einige formale Verfahren, die sich wiederholen: Kleinschreibung, Reihung,
versetzte Verssetzungen, teils aber auch der Wechsel zwischen groß und klein
gesetzten Versen. Der Gedichtband bewegt sich damit zwischen Flüstern und
Schreien. Das wichtigste Thema des Bandes ist zweifelsohne die Krankheit. Im
Abschnitt „Schsch“ wird sie als entscheidender
Erfahrungsraum gefasst, aus dem sich Sprache erst fragmentarisch wieder
herausarbeitet:
ich krankwie krankbin krankwie mein körperheilung findet woanders stattheilungich bin ungeheilt
Hier
entsteht eine Poetik des Leidens, in der sich die Brüche des Körpers in der
Sprache spiegeln. Besonders im dritten Abschnitt, „Klagen“, verdichtet sich
diese Haltung durch ein typografisches Verfahren: Ein grauer Hintergrundtext
legt sich flächig über die Seite, darüber der eigentliche Gedichttext in
schwarzer Schrift. Das „Ichnetz“ zeigt sich hier als Struktur, als visuelle
Überlagerung. So entsteht ein Wahrnehmungsraum zwischen Bild und Sprache, der
sich der klaren Festsetzung entzieht und vielmehr als Erfahrung lesbar wird.
wie lichtmein augeich lacheich möchte weinenunendlichvernetzung des gehirnsich lasse mich fallenjahrelangich hasse michwie einen krankengestern nachtfiel ein mondneben mich
Die
abschließende Poetologie (Das
Ichnetz) spiegelt die
zuvor vermittelte Haltung in essayistischer Form. Sipos tritt hier als „armer
Landmann ohne jegliches Wissen“ auf. Schreiben sieht Sipos als den Ausdruck von
Wahrheit durch den Wechsel zwischen Schreiben und Denken. Allerdings könne man
im Schreiben nie die gesamte Wahrheit ausdrücken, da kein Mensch über die
komplette Wahrheit verfüge. Für Sipos ist Schreiben vor allem eine Geste, ein
Ausführen von Tippbewegungen, von Handgesten, bei denen sich das Denken in den
Fingern und Muskeln manifestiert und in Buchstaben überführt wird.
Auch
der Witz darf in Sipos’ schreiben über all das Leid und die Körpererfahrung
nicht vergessen werden. Allein Titel wie „(Nachtgesang) Schsch“ oder „(Skizzen)
Klumpen“ und auch der titelgebende Name für den Zyklus Klumpen zeigen,
dass der Autor spielerisch mit tradierten Gattungen, literarischen Systemen und
Normen umgeht und diese in seinem Sinne umdeutet, stets mit einer Prise Salz.
Die
Poetologie liest sich wie ein Gegenentwurf zum akademisch abgesicherten
Selbst-verständnis poetischen Sprechens: weniger Theorie als Versuch, sich dem
eigenen Schreiben zu nähern. So lässt sich Klumpen
auch als ein Band lesen, der das Ich nicht erhebt, sondern befragt
und in ein Geflecht aus Text, Körper und Geist überführt.
Peter Sipos:
Klumpen. Gedichte und Poetologie. Berlin (Gans Verlag) 2023. 120 S. 24,00
Euro.


