Michael Töteberg, Alexandra Vasa: Ich gehe in ein anderes Blau
Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen
Franz Hofner
Michael Töteberg, Alexandra Vasa: Ich gehe in ein anderes Blau. Rolf Dieter
Brinkmann – eine Biografie. Hamburg (Rowohlt Buchverlag) 2025, 400 Seiten.
35,00 Euro.
Es gibt viele Kriterien, nach denen man urteilen kann, ob eine Biografie gut
ist: man wird wenige finden, die das vorliegende Buch nicht erfüllt. Die
naheliegendste zuerst: es ist gut geschrieben, ein stringenter, weitgehend –
aber mit sinnvollen Vor- und Rückgriffen - chronologischer Aufbau, eine
flüssige Diktion, eine überzeugende Mischung aus eigenen Formulierungen und
Zitaten, viele davon aus dem bisher nicht zugänglichen Nachlass – es macht
keine Mühe, das Buch zu lesen und mit Sicherheit werden auch Brinkmann-Fachleute
jede Menge Neues entdecken. Einfühlung in das schwierige Wesen und die
komplexen Anliegen, die Brinkmann umtrieben. Kritische Distanz, die transparent
bleibt, gerade wenn eigene Urteile der Autoren einfließen, wie es wohl bei
jeder Biografie unvermeidlich ist.
Die beiden Autoren hatten die Möglichkeit, als Erste den Nachlass sichten zu
dürfen, allerdings einen noch nicht erschlossenen Nachlass, der nur durch
glückliche Umstände im Marbacher Literaturarchiv landete - die Stadt Köln war
nur halbherzig interessiert gewesen. Genauer gesagt sollte nicht ausgeblendet
sein, dass hinter der Floskel von ‚glücklichen Umständen‘ in der Regel
engagierte Menschen (in dem Fall die Kulturstiftung Brinkmann in Vechta)
stecken, die Dinge tun, die sie nicht tun müssten, in diesem Fall bereits in
Plastiktüten verpackte Entwürfe, Notizen, Briefe durch einen spontan
angemieteten LKW und einen Trip von Vechta nach Köln vor dem Entrümpler zu
retten.
Eine weitere Stärke des Buches ist das Zeitpanorama, das es aufspannt. Nicht
nur die muffigen 50er Jahre - Brinkmann ist 1940 geboren - werden zum Leben
erweckt (Brinkmann würde den Ausdruck „Leben“ für diese Zeit nicht goutieren),
auch die 60er werden nahegebracht, natürlich mit dem Schwerpunkt des
literarischen Lebens, aber auch knappe Exkurse in Malerei und Musik, sofern sie
Brinkmann beein-flussten, sind enthalten, mir sind keine Lücken aufgefallen, an
denen ich mehr Material gewünscht hätte. Es ist recht erfrischend, diversen
‚großen Namen‘ der literarischen Gegenwart (wenn sie denn noch leben) in der
Frühphase ihrer Karriere zu begegnen.
Michael Töteberg ist auch Herausgeber der Neuausgabe von Westwärts,
die ebenfalls 2025 bei Rowohlt erschienen ist, und, neben neuen Gedichten aus
dem Nachlass und einem Nachwort von Töteberg, auch das lange Nachwort von
Brinkmann, eine seiner letzten Arbeiten vor dem Unfalltod im März 1975,
enthielt.
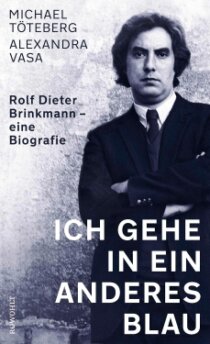
Vor der Folie dieses Brinkmannschen Nachworts – ein sehr grundlegender
Verriss der Moderne, in die er sich hineingeboren fand - stellen sich einige
weitere Fragen an eine adäquate Biographie, die spezifisch für eine Person wie
Brinkmann sind. Üblicherweise werden Vokabeln wie ‚enfant terrible‘
herangezogen, um ihn zu beschreiben, seine Ausfälle, sein Widerstand gegen das
gesellschaftliche Leben und den Literaturbetrieb, aber auch seine
Widersprüchlichkeit im Widerstand, die schnell ins Naiv-Verworrene abrutschte,
wenn es darum ging, eine Welt zu konzipieren, die ihm lebenswert, ‚lebendig‘
erschienen wäre. Andere sprachen von Kotzbrocken, Reich-Ranicki nannte ihn im
Nachruf in der FAZ einen ‚unzurechnungsfähigen Poet‘. Die Ablehnung von
bürgerlich-braven, staatstragenden Verhal-tensweisen und den Hinweis auf ihre
ablähmenden, den Menschen unter seine Möglichkeiten ziehenden Wirkungen ist
zentral für Brinkmanns Sicht auf die Dinge – hier kannte er dann weder Freund
noch Feind. Eine Literatur, die vor dem Staat kuscht und sich durch Stipendien
– wie er es etwa in der Villa Massimo in Rom erfuhr – einhegen lässt, war ihm
zuwider. Es ist nur konsequent, dass er sich dort nicht als von Dankbarkeit
erfüllter Gast sah, sondern als Souverän, dem die Leistungen nach Erfüllung der
Auswahlkriterien zustanden. Die Antriebe Brinkmanns werden im Buch ausführlich
referiert, wenn auch mit deutlich spürbarer Reserviertheit.
Ich denke nicht, dass ein genau empfindender Diagnostiker in der Lage sein
muss, für wahrgenommene Mängel die Lösungen bereit zu stellen. Brinkmann lebte
und schrieb aus der Kritik an der um ihn herum existierenden Gesellschaft und
Literatur. Er hat sich, das macht die vorliegende Biographie sehr deutlich, aus
ungünstigen Startbedingungen tiefgreifend entwickelt, nicht in allen Bereichen
des Lebens, aber mit beeindruckender und nicht leicht bei anderen zu findender
Konsequenz, im Widerstand gegen alles sich verbiegen lassen. Wenn es irgendwas
an dem Buch von Töteberg/Vasa auszusetzen gäbe, dann vielleicht ein noch etwas
expliziterer Hinweis darauf, dass Kotzbrocken ein hoch anzurechnendes
Kompliment sein kann.


