Marion Poschmann: Nimbus
Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen
Philipp Schlüter
Marion Poschmann: Nimbus.
Gedichte. Berlin (Suhrkamp Verlag) 2020. 115 Seiten. 22,00 Euro.
Der Blick des Westens nach
Sibirien war schon immer ein Blick ins Wilde, ewig Große, ein Schauen in die
Ewigkeiten der eisigen Tundra, der nadelbaumbestandenen Taiga und der baumlosen
Steppe. Hin zu einem gewaltig großen Raum, in dem Menschenleben unbemerkt verwehen
wie die Winde der Steppe. Eine „ungewisse“, eigentlich nicht vollständig
wahrnehmbare Landschaft, ganz nach dem Geschmack der vielfach prämierten
Lyrikerin Marion Poschmann. Die in Berlin lebende Dichterin, die für ihre
lyrischen, „außerordentlich genauen Naturbilder“ 2017 mit dem Preis für Nature
Writing ausgezeichnet wurde, bringt uns in ihrem neuen Lyrikband Nimbus diesem
unfassbaren Landstrich zwischen Ural und Pazifik sowie den nordatlantischen
Eismassen und der Mongolei auf dem Weg der Dichtung gekonnt näher. Es sind die
gewohnten lyrischen Landschaftsvermessungen, wie man sie beispielsweise aus Geliehene
Landschaften (2016) kennt, die die Autorin auch hier vornimmt: evokativ-suggestiv,
sich mal konkreter erschließend, doppelbödig, dann wieder ins Enigmatischere
abdriftend. Das ist Dichtkunst à la Poschmann wie man sie kennt: sie fordert
uns wieder heraus, erfreut uns durch neue Wortzusammensetzungen, einzigartige,
dichte Sprachbilder und bewusst gesetzte Vexierspiele in Versform. Marion
Poschmann ist eindeutig eine Autorin, die ihr lyrisches Fahrtwasser gefunden
hat – den drohenden Verschiebungen im klimatischen Erdgleichgewicht kann die
Dichtung leider nicht Einhalt gebieten, und doch wäre ein lyrisches Ignorieren
dieser Fakten und eine Flucht in eine naturmagische Schule, in dem die Zeit
stehengeblieben zu sein scheint, auch keine adäquate Option. Deshalb stellt Marion
Poschmann in einem ihrer letzten Gedichte des Buches folgende Überlegung in den
Raum:
Rettung des Weltklimas aus/ dem Geiste der deutschen Ode –/ haben wir uns da nicht etwas/ viel vorgenommen?/ wir, die wir vornehmlich/ mit Stanniolpapier spielen/
Retten ja, denn dafür brauchen wir die aktive Tat in der
Welt. Die Sinne schärfen? Nein, da hat die Autorin sich nicht zu viel auf die
Agenda geschrieben, das ist mehr als machbar und vollzieht sich in der
bewussten Auseinandersetzung mit den eigenwilligen, intelligenten Gedichten.
Und genau diesen Anknüpfungspunkt erschafft die Lyrikerin Marion Poschmann
äußerst kunstvoll. Um etwas zu schärfen, muss es wiederholt an einem härteren
Gegenstand geschliffen werden.
Ich taute Grönland auf mit meinem Blick/ ich schmolz Gletscher, während ich sie voll/ der Andacht überflog
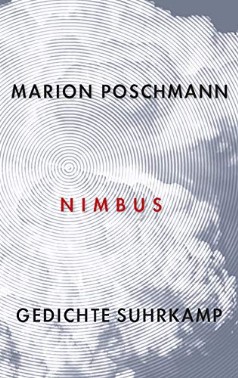
Der Blick aus dem Flugzeugfenster ist majestätisch, aber
eben auch ganz ursächlich für das Verschwinden von Gletschern und
Meereseismassen. Wohin die lyrische Reise geht, unterstreicht das dem Gedicht
vorangestellte Zitat aus Sophokles Antigone ganz direkt: „Vielgestaltig
ist das Ungeheure, und nichts ist ungeheurer als der Mensch.“ Unheimlich muten
auch die titelgebende Gewitterwolke Nimbus sowie andere
Naturerscheinungen an – die unheimlichste, verhängnis-vollste Erscheinung für
die Natur bleibt aber eben der Mensch. Im Gedicht Restschnee wird die
„Industrievernunft“ enttarnt, die nach den Erdölvorkommen in Sibirien greift
und sich vormals unberührte Landschaften dienstbar macht:
Laß uns von Erdöl sprechen. Als der helle Tag/ wie jedesmal von seiner Plattform kippte,/ wuchs mir ein Pelz aus Pipelines, ich war Sonne,/ und meine Strahlen reichten bis nach Sibirien/ […] Götze der durch Röhren fließt
Der hier angedeutete Strahlenkranz der Sonne lässt an eine
zweite Bedeutung des lateinischen Wortes nimbus denken: den
Heiligenschein. Schon der Titel der Lyriksammlung folgt einer Poschmann‘schen
Poetik von Doppeldeutigkeiten. Wie sehr dabei in diesem Band alles miteinander
zusammenhängt, veranschaulicht auch ihr Sonettenkranz Die große Nordische
Expedition. In 15 Dioramen, in dem Marion Poschmann ihr traditionsreiches lyrisches
Können formbewusst unter Beweis stellt und die Entdeckungsreise des
Sibirienforschers Johann Georg Gmelin von 1733 in 15 Sonetten lyrisch verarbeitet.
Im dem Gedichtzyklus „Animismus“ erfreut uns die Lyrikerin mit acht
Tiergedichten: Krähen, Quallen (welche die Autorin als ihr persönliches
Wappentier ausgewählt hat; https://www.fu-berlin.de/campusleben/lernen-und-lehren/2018/180606-Marion-Poschmann-Antrittsvorlesung/index.html) und Schafen
(ihr zweiter Gedichtband trägt den Titel „Grund zu Schafen“, 2004). Was sie
lyrisch betreibt, ist fast immer auch Naturdichtung, die – agiert man mit
diesem Begriff – eine Tradition und verschiedene Ausprägungen der letzten
Jahrhunderte heraufbeschwört. Landschaften, Tiere, Pflanzen und das Wetter sind
auch ihre zentralen Motive, die sie aber immer mit dem Bewusstsein für
gegenwärtige zivilisatorische Zersiedelungen sowie dem Drang, sich Räume zu eigenen
zu machen, ironisch aufbricht und neu durchdenkt. So bindet sie in der zweiten ihrer
Seladon-Oden Denkfiguren der Anakreontik in ihr lyrisches Wirken über
die spezielle, graugrüne Farbe von Seladon-Keramik mit ein:
auf Treppenabsätzen aus altem Waschbeton/ die Anakreontik vor dem Gewitter
Die Autorin dichtet – unter offenkundigem Rückbezug auf die
traditionelle Schule der Naturdichtung – ganz unter den gegenwärtigen,
besorgniserregenden klimatischen Veränderun-gen, die der Mensch in seinem ‚Beschädigungsmodus
Kapitalismus‘ so anrichtet. Der Mensch wird zu einer Schicksalsmacht, zu einer
Art Daimon, wie sie den letzten Gedichtzyklus in Nimbus nennt, der
in Landschaften und vormals sakrale Orte einbricht. Im Gedicht Nymphaion
betritt ein lyrisches Ich ein antikes Nymphenheiligtum, das nur noch als
Schatten ohne Leben erscheint:
wie kalte Stücke einer Gymnastikübung/ der Bronzeleib am Wasserbecken/ […] schon sehe ich nicht mehr der locker gestaffelten Wellen/ […] zerrissen/ barocke Tapetenmuster, die treibenden Ahornblätter/ im Uferbereich. Hinter den Hochspannungsmasten
Marion Poschmann ist neben ihrem genauen Blick für
zivilisatorische Beanspruchungen unterschiedlicher Naturräume auch eine Chronistin
des sibirisch-asiatischen Raumes – landschaftlich als auch
philosophisch-kulturell. Ihr 2005 erschienener Schwarzweißroman spielt
in Magnitogorsk, einer riesig angelegten Planstadt im Ural. Und der
Gedichtzyklus Matshushima – Park des verlorenen Mondscheins aus dem erwähnten
Lyrikband Geliehene Landschaften beschreibt ein lyrisches Ich, das sich
auf den Spuren des japanischen Wanderpoeten Matsuo Bashō
auf die kiefernbestandene Bucht von Matsushima zubewegt, ein Gedicht dieses
Zyklus‘ trägt den Titel Die Kieferninseln. Marion Poschmann hat unter
diesem Titel 2017 auch einen Roman veröffentlich, in dem sie eben das prosaisch
nacherzählt, was in jenem Gedichtzyklus bereits angelegt war: die
(Pilger-)Reise des europäischen Wissenschaftlers Gilbert Silvester, der sich
ins Land der aufgehenden Sonne begibt und sich dort mit Bashōs Auf schmalen
Pfaden durchs Hinterland als Lektüre zur Mondbetrachtung an die Bucht der
Kieferninseln aufmacht. Mit Marion Poschmanns Nimbus, ihrer neusten
lyrischen Veröffentlichung, nähern wir uns dem sibirischen Raum auf ihrem
„schmalen Pfad der Dichtung“. Dabei sind die versammelten Gedichte voll von
gedanklich-hintergründigen, auf den ersten Blick unauffälligen Verknüpfungen.
In der letzten Strophe des Gedichtes Die magischen Objekte meiner Großmutter
heißt es: „[…] nach der bewährten Taktik:/ Nähe und Ferne vertauschen,
Strategem sechs.“ Das Ferne soll nah rücken und das Nahe soll fremd werden,
damit es aus einer anderen Warte betrachtet werden kann. Aber wie könnte man
sich einen sinnvollen Reim auf jenes „Strategem sechs“ machen? Die wenigsten
dürften wissen, dass es sich dabei um eine Anspielung auf die Sechsunddreißig
Strategeme des chinesischen Generals Tan Daoji handelt, dessen sechstes besagt:
„Im Osten lärmen, im Westen angreifen“.
Marion Poschmann legt in ihren Gedichten und prosaischen
Texten Fährten aus, die Leserinnen und Leser immer wieder auf die zentralen
Denkbewegungen sowie Themenfelder ihres Schaffens hinweisen. Das dem Büchlein
den Titel gebende Gedicht Nimbus – es schließt den Gedichtband ab – greift
Yugen, den ostasiatischen Begriff der erhabenen Tiefe auf. Wie an dieser
Stelle in Versform wird auch in Die Kieferninseln ein kurzer Exkurs über
diese ästhetische Dimension eingeflochten. Dies geschieht in besagtem Gedicht
mitunter sehr technokratisch. Zum Ende lesen wir: „Dunkelheit denken: nicht wie
ein Berg,/ eher wie ein negatives Gebirge“. Dieses dunkle, „negative Gebirge“
ist in Entsprechung eben jene spezielle Wolkenart, die dunkel drohend am
Horizont aufzieht und Gewitter, Regen, Hagel und Schnee mit sich trägt. Bemerkenswert
ist hier, dass Poschmann ihrem neuen Gedichtband eine kurze Passage aus
Klopstocks bekanntem Gedicht Die Frühlingsfeyer (1774) voranstellt, welches
in Goethes Werther eine zentrale Rolle im Sinne eines
zwischenmenschlichen Codes zwischen Werther und Lotte darstellt. Mit Klopstock
steht hier zugleich eine Empfindsamkeit im Raum, die einen dichterischen Pakt
mit dem individuellen, einzigartigen Gefühl des Sturm und Drang und der
Ablehnung einer allein vernunftorientierten unspirituellen Lebensweise aufleben
zu lassen scheint. Diese literarische Spur ist durch das Klopstock-Zitat wie
ein Band um Nimbus gelegt.


