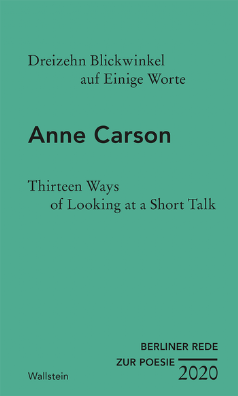Kristian Kühn: Der Versuch, Grenzen zu überwinden
Diskurs/Kommentare > Diskurse > Kommentare

Kristian Kühn
Der Versuch, Grenzen zu überwinden
Wir befinden uns in einer Zeit, in der die vorhandenen Grenzen, auch Begrenzungen durch die conditio humana wie durch die Natur allgemein, möglichst überprüft, wenn nicht überwunden werden sollen. Eines der Instrumentarien für die Auflösung hergebrachter Knoten im Denken und Verhalten soll dabei die Worthygiene sein, Grenzen stabilisierende Begriffe und Denkmuster zu isolieren und eines Tages obsolet zu machen, spielerisch poetisch zu umweben, was insgesamt allerdings erneut wiederum zu Ablehnung und neuen Grenzen führen könnte. In jedem Fall sollen egozentrische Alleingänge aller Art möglichst in das Gefüge eines Ganzen eingeordnet und eingebunden werden, bleiben sie auch noch so umstritten.
Und so nimmt es nicht Wunder, dass das Netzwerk Lyrik in Kooperation mit diversen Institutionen und Stiftungen und im Rahmen des staatlichen Programms „Neustart Kultur“ im Herbst 2021 in München eine Konferenz einberufen hatte, unter dem Titel: „Eins: zum andern“ (entlehnt von Karin Fellners letztem Gedichtband, der so heißt), um Gemeinsamkeiten von Wissenschaft und Lyrik auszuloten. Kuratiert wurde diese dreitägige Konferenz (16. - 18. September) von Tristan Marquardt, Alexander Rudolph, Christian Metz und Anja Utler.
Eine dieser Veranstaltungen fand am Freitag, dem 17. September, vormittags in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, im Sitzungssaal 1, statt, und zwar unter der sehr leisen, aber stringenten Leitung von Uljana Wolf: „Die Redeform ‚Lyrik‘ oder Was ist eigentlich poetisch?“
Das hufeisenförmig zusammengesetzte Panel bestand aus Marc Matter (Klangkünstler), Frieder von Ammon (Universitätsprofessor Leipzig), Josefine Berkholz (spokenword), Nico Bleutge, Uljana Wolf, Nadja Küchenmeister, Claudia Hillebrandt (Literaturwissenschaft Jena), Alexandra Tretakov (wissenschaftliche Mitarbeiterin für Übersetzungsprozesse, Trier) sowie Ricardo Domeneck – und war somit von queer bis offizieller Lehre in alle Sparten durchdekliniert, und obendrein personell nur wenig geringer als die dem Hufeisen gegenüber in Abständen hockende Zuschauergruppe, so dass die Moderatorin gerne das Panel enger zu einer Art Arbeitsgemeinschaft zusammengeführt hätte, was aber aufgrund der bayerisch-behördlichen Corona-Bestimmungen nicht ermöglicht werden konnte.
Wie kommt das eine zum anderen beim Schreiben? Und sind sie zusammen dann beide oder doch nur eines auf einem höheren oder einem niedrigeren Level? Diese Frage konnte letztlich nicht beantwortet werden, weder im subjektiven noch objektiven Sinne. In seinem Vortrag „Das hier ist Wasser“ schrieb David Foster Wallace einmal: "Das vielleicht Gefährlichste an einer akade-mischen Bildung ist - zumindest in meinem Fall -, dass es die Neigung zur Überinterpretation verstärkt. Ich verliere mich in Abstraktionen, statt auf das zu achten, was sich vor meiner Nase abspielt. Statt auf das zu achten, was sich in mir abspielt." Diese Dualität, wenn nicht sogar Pluralität, von Platon „unbestimmte Zweiheit“ genannt, wurde im Panel als eine Art Negation von Grenze aufgefasst. Das Eine, das zum Andern gelangen und in diesem aufgehen sollte, könnte. Und so ging es zunächst um das Inkommensurable an sich, um die Lücken und Sprünge beim Erfassen und Schreiben auch. Was als solches ein Gedicht ist, und was passiert, wenn wir eine wissenschaftliche Prüfung einschalten?
Anhand des Beispiels der Arbeiten von Christine Lavant definierte der Literaturwissenschaftler Frieder von Ammon das Gedicht als ein Konstrukt, das „körperliche Ausdrücke in Sprache umsetzen“ könne.
Und, obwohl die Aufmerksamkeit dabei auf der Stilart von Sprache liege, gehe es auch, wenn nicht primär, darum, die sich ergebende Trennung von fixierter Schrift zu ihrer Performance, ihrer körperlichen Anwesenheit mit ihren dadurch entstehenden physischen Übertragungsmöglich-keiten, zu überdenken und wenn möglich zu überwinden (Domeneck, Ammon), gerade das bilde auch eine zweite Ebene, eine Phantomwörter-Ebene beim Hören, beim subjektiven Aufnehmen von Klang, sobald Rhythmus und Klang, sprich Musikalität, hinzukämen. Als Gegenbewegung der Veräußerung sei zugleich mit einer Entkörperlichung des Gehörten beim Aufnehmen bzw. Internalisieren zu rechnen, was zu einem innersprachlichen Gespräch mit der Sprache (Wolf) führen würde, zu einem Zwischenraum, zu „unauflösbaren Inseln“ (Küchenmeister) innerhalb der vermischten Wahrnehmung, die sich wiederum im Körper fixiere, einschreibe.
So dass Ammon zu der Definition kam, was Lyrik im Gegensatz zur Wissenschaft auszeichne, sei eine „Kategorienresistenz der Lyrik“ – sie hätte „die Tendenz zur Transgression in alle Richtungen“, sei sozusagen grenzüberschreitend in ihrem intuitiven Wissen.
Was abschließend auf die Berliner Rede zur Poesie 2020 von Ann Carson zustrebte, auf „Dreizehn Blickwinkel auf Einige Worte dazu, (worüber ich am meisten nachdenke)“, und zu ihrem „wahren Irren der Poesie“, denn für Carson gibt es keine festen Grenzen, weder bei Poesie und Essay, noch Antike und Moderne:
Aristoteles sagt, die Metapher erlaubt dem Denken sichselbst dabei zu erlebenwie es einen Fehler macht.Er stellt sich vor wie das Denken sich über die glatteOberflächegewöhnlicher Sprache bewegtund diese Oberflächewird auf einmal brüchig oder kompliziert.Unerwartbarkeit taucht auf.
Alles wirkt zunächst sonderbar, widersprüchlich oder falsch.Dann ergibt es Sinn.Und in diesem Moment, so Aristoteles,wendet sich das Denken an sich selbst und sagt:„Wie wahr! Und doch hatte ich mich geirrt darin!“Aus dem wahren Irren der Metapher lässt sich etwaslernen.
Nicht nur, dass die Dinge anders sind als sie scheinen,weshalb wir uns in ihnen irren,sondern auch, dass diese Irrtümer wertvoll sind.
Ann Carson: Dreizehn Blickwinkel auf Einige Worte. Deutsch/Englisch. Aus dem Englischen
von Anja Utler. Reihe: Berliner Rede zur Poesie; Bd. 5 / 2020. € 13,90 (D) / € 14,30 (A).