Julia Grinberg; Journal einer Unzugehörigkeit
Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen
Monika Vasik
Julia Grinberg: Journal einer Unzugehörigkeit. Gedichte und
Texte. Nettetal (ELIF Verlag) 2025. 140 Seiten. 20,00 Euro.
„Mein Nervenkostüm ist ein löchriger Lumpen“
2019 debütierte Julia Grinberg mit dem Lyrikband kill-your-darlinge im Gutleut Verlag.
Nun legt sie ihre zweite Buchveröffentlichung vor, die eine so komplexe wie
gelungene Mischung aus kurzen Prosatexten und Gedichten beinhaltet. Die Autorin
hat ihre reichen Erfahrungen des Befremdens, des Sich-fremd-Fühlens und des Fremdseins
in so ergreifende wie lehrreiche, zugleich bittere und amüsante Literatur
verwandelt.
Gegliedert ist ihr Journal
einer Unzugehörigkeit in sechs Kapitel, in denen meist aus der
Ich-Perspektive Momentaufnahmen und alltägliche Szenen eines turbulenten
In-der-Welt-Seins nachgezeichnet werden. Dabei greift die Schriftstellerin in
der Art und Weise, wie sie Ereignisse, Erinnerungen, Gedanken und Gefühle
einfließen lässt, die sich tief in sie eingeschrieben haben, die Tradition des
mündlichen Erzählens auf. Und sie hinterfragt den Sinn und die Ziele ihres
Lebens, das sie von der UdSSR über die DDR und die Ukraine schließlich im Jahr
2000 in die BRD führte.
Als was fühle ich mich?Als Zwischenbemerkung eines Zustandes.Eine fortlaufende Zweckentfremdung eines Daseins
An anderer Stelle heißt es: „Ich dachte, ich wäre in
Sicher-heit, ich habe viel durchgemacht.“ Es ist der Beginn des Ukrainekriegs.
Doch angesichts der Feindseligkeiten deutscher Putin-Verehrer muss sie sich
eingestehen, dass ihre vermeintlich „sichere Insel“ nicht sicher ist, sondern
„wackelig“. Dieses Motiv taucht noch einmal an anderer Stelle auf, nämlich bei
einer Autofahrt, und kann ebenfalls als Symbol für ihr Dasein in der Welt
gelesen werden:
Stau stehen, ausharren. Harndrang, Handymanie.Falsche Spur erwischt. Rechts fahrendie einen an mir vorbei, links fahren die anderenmir entgegen, meine Bewegung ist ein Wackeln
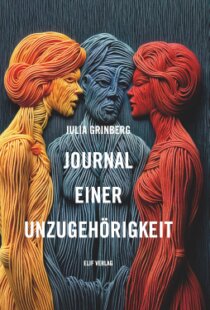
Grinberg steht heute in der Mitte ihres Lebens, blickt
zurück und zieht Bilanz. Es ist eine Inventur, die nichts vortäuscht und die
eigene Person nicht schont. Sie bleibt wahrhaftig, wenn sie ihren schweren
Rucksack von den Schultern hievt und ihn öffnet, darin gräbt, nach Gründen und
Ursachen forscht für das, was sie warum wie geworden ist und wie sie sich heute
durch die Tage schlägt. Geradezu beiläufig flechtet sie angesichts vergangener
und aktueller Bitternisse vage Vorsätze für die Zukunft ein, denen ihre Zweifel
angesichts des Erlebten inhärent sind:
„Ich erwäge, ein optimistisches Szenario für die nächsten Jahre auszumalen.“
Den größeren Teil ihres Journals nehmen kurze, bis zu einer
Seite lange Prosatexte ein. Es sind Minutennovellen, ein Begriff, der vom
ungarischen Schriftsteller István Örkény (1912-1979) geprägt wurde. Es sind
Erzähldestillate, die mit wenigen Sätzen Träume skizzieren, Lebensmomente und
Erinnerungen ausmalen und Stimmungen ohne Larmoyanz präzis auf den Punkt
bringen, sie manchmal ins Absurde oder ins scheinbar Absurde wenden, oft
gewürzt mit Lakonie, einem Schuss Zynismus und mehr als nur einer Prise
Melancholie, die den Gedanken an den Tod als Möglichkeit genauso einbezieht wie
ihre Angst, sich zu verlieren.
Die Titel von Grinbergs Texten beginnen fast immer mit
Kleinbuchstaben, was den Eindruck eines bruchstückhaften, sich langsam
entwickelnden Erzählens verstärkt, das dem diskontinuierlichen Fluss des
(Nach)Denkens ähnelt und ein Leben allmählich mosaikartig vor unseren Augen
entstehen lässt. Diese Titel bestehen meist aus kurzen, manchmal fragmentierten
Sätzen ohne Satzzeichen, in denen Wochentage erwähnt werden, wie „am Mittwoch
erfand ich ein Absurdometer“, „letzten Freitag freier Fall“ oder „am Dienstag trug
ich meine Angst zu Grabe“, was den Eindruck eines Journals bestärkt, entfernt
auch einem Tagebuch ähnelt. Doch es weist darüber hinaus, da es keine
Datierungen gibt und ein Wochentag ohne Jahresangabe bloß der bewusste
Entschluss einer (vorläufigen) Festschreibung ist, für die gleichwohl fast
jeder andere Tag eines Jahres möglich wäre. Denn wie es im Titel eines Textes
heißt, „es spielt keine Rolle, ob nun Dienstag oder Mittwoch war“.
Inhaltlich reichen die Episoden von der frühen Kindheit bis
ins Heute. Sie bezeugen ein Aufwachsen in einem lieblosen Elternhaus, in dem
Mahlzeiten als „Liebesrudiment“ dienen und ein „Indiz der Gunst“ sind. Sie
erzählen vom Ausgesetztsein, von menschlichen Schwächen, der Sehnsucht nach
einer Umarmung und dem erfolglosen Bemühen, der sich entziehenden Mutter alles
recht zu machen, um ihr zu gefallen. Sie lernt, das einzig Wichtige im Leben
sei zu funktionieren. Sie verdient früh Geld und schlägt ihre Zeit tot mit für
sie bedeutungslosen Brotjobs.
„Handelsreisen, das traurige Geschäft, meine Übung in Demut und Selbstverleugnung.“
Grinberg zeigt in ihren Überlegungen ein feines Gespür für
Nuancen, macht auf differenzierte Weise die Hilflosigkeit, erfolglose
Auflehnung und Orientierungslosigkeit begreifbar. Sie weiß von Sehnsüchten,
ihren Ängsten und Panikattacken zu berichten, die sich angesichts des
Ukrainekriegs noch verstärken. Und sie erzählt von früher Überforderung, „als
ich schon Studentin, Ehefrau, pflegende Tochter einer krebskranken Frau war“.
Hart geht sie auch mit sich als Mutter ins Gericht, weil sie denkt, dass sie in
dieser Rolle ständig versagend ist. Dazwischen knallen Merksätze,
Selbstermahnungen und Gebote, mit denen sie sich zur Härte gegen sich selbst
und zum Weitermachen zwingt:
„Tränen stiegen hoch. Bloß nicht! Zurückhalten! Durchhalten.“
Die Ich-Figur erkennt, „ich, wie ein jeder, bin alleine“.
Doch Grinberg ist im Besitz ihrer präzisen Sprache, mit der sie sich selbst
ermächtigt und ihr Schicksal auf einzigartige Weise in Literatur verwandelt.
Schreiben heilt nicht, aber es schafft Abstand und ist eine Form der
Bewältigung, des Selbstgesprächs sowie des (Mit)Teilens. Die Schriftstellerin
entfaltet kein bloß privates Schicksal, sondern eine für ähnlich reiche,
vielfach gebrochene Biografien prototypische Erzählung. Grinberg erschafft mit
ihrer Ich-Figur kein papierenes Wesen, sondern einen interessanten Menschen aus
Fleisch und Blut, aus Freuden und Leiden, aus Schönheit, Wunden und Not, eine
Frau, die zudem über herrlichen Humor verfügt, der sich gelegentlich Richtung
Sarkasmus oder Ironie verschiebt.
„So schrieb und schreibe ich mich selbst, gebe mir eine zeitweilige Bescheinigung meiner, hänge an diesem seidenen Faden.“


