Jörg Fauser: Ich habe große Städte gesehen
Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen
Timo Brandt
Jörg Fauser: Ich habe große Städte gesehen. Die Gedichte. Zürich (Diogenes Verlag) 2019. 352 Seiten. 24,00 Euro.
Enzyklopädien des täglichen Irrsinns
„vier-fünf U-Bahn-Stationenall die Woolworth-Mädchen mit Lippenstiftund Beatles im Ohr und die Männchen mitihren Trauerhüten und Regenschirmen undso viel Charme im Gesicht wie ‘ne Schreibe Ersatzschinkenalso auch alles Verlierer ihr Einsatzso klein dass es keiner merkte“
Naturgedichte werde man hier keine finden, merkt Björn Kuhligk im Vorwort zu der Ausgabe der Gesammelten Gedichte von Jörg Fauser an. Die Natur habe ihn nicht interessiert, sein Augenmerk habe immer auf den Städten gelegen, dem Urbanen – und der Natur des Menschen, der in diesen großen urbanen Gebilden lebt.
Im Vorwort fällt auch direkt ein Name, der für mich in allen Gedichten Fausers omnipräsent ist und sich nur schwer abschütteln lässt: Charles Bukowski. Selbst wenn Kuhligk seinen Namen nicht genannt hätte (neben Jack Kerouac und William S. Burroughs), wäre er wohl für jede/n als Pate nicht zu leugnen, der/die schon mal ein Bukowski-Gedicht gelesen hat. Fausers Texte sind von derselben klinisch-rebellischen Todesverachtung, denselben mäandernden Aufzählungsfassa-den und einer manchmal heiter werdenden Hoffnungslosigkeit geprägt, die auch in Teilen von Bukowskis lyrischem Werk tonangebend sind. Genau wie bei Bukowski, stilisieren die Gedichte ihren Autor zum Außenseiter, zum Vagabunden – es sind
„Gedichte, geschrieben von einem, wie es in seinem Roman ‚Rohstoff‘ heißt, »Außenseiter, der bei den Außenseitern auf der Außenseite sitzt«. Diese Gedichte erzählen, sie bleiben selten stehen, sie treiben voran.“
Kuhligk bemüht sich redlich, aus Fauser im Vorwort einen Lyriker von Format zu machen und für manche mag er das auch nach der Lektüre der Gesammelten Gedichte noch sein. Ich muss sagen, dass für mich über die ganze Länge des Bandes der Eindruck einer herben Enttäuschung entstand.
Klar, am Anfang waren sie aufregend, die leicht anarchische Fabulierlust und die amerikanisch angehauchten Settings. Doch bald schon gestand ich mir ein, dass die meisten aufgeworfenen und gleich wieder abgehängten Szenen und Szenerien für mich bloße Abbilder blieben; nichts davon, keine Geschichte oder Figur, hinterließ wirklich einen nachdrücklichen Eindruck, regte zur weiteren Beschäftigung mit etwas an.
Ich versuchte die Gedichte als Bewältigungsarbeit zu verstehen oder als Kartographie menschlichen Elends, des Sumpfes der urbanen Abgründe. Wollte Fauser vielleicht nicht wie Charles Bukowski, sondern wie Allen Ginsberg sein, die besten Köpfe seiner Generation zerstört von Alkohol, Drogen und Perspektivlosigkeit? Oder wollte er doch wie Charles Bukowski sein (der, ebenso wie sein deutscher Übersetzer Carl Weissner, in den Gedichten immer mal wieder vorkommt), der Sänger der Abgehängten und täglich Schuftenden und ihrer kleinen Siege und Niederlagen, ihrer aussichtslosen, dennoch zu beschreibenden Existenz?
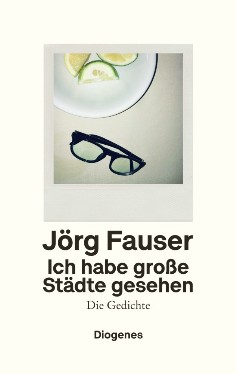
„Mir geht’s wie euch, zu den Fragender Zeit fällt mir auch nur mehr Unsinn ein,aber ich hoffe, es gibt in der Leipziger Straße,in Frankfurt, an der Bockenheimer Warte,noch die Imbissstube, wo ich oftmit meinen Freunden, den Nachtwächternund Schlafwandlern hockte und über Bierund Fritten die Fragen erörterte,ob Durutti den tödlichen Schuss nichtdoch in den Rücken gekriegt hat“
So und noch auf andere Arten versuchte ich Fauser zu
verstehen. Aber es blieb dabei, dass seine Texte mir seltsam uneigenständig
vorkamen – selbst die Wucht darin: eher eine kalkulierte, eingepflegte
Angelegenheit. Und ein Gedicht (mit wenigen Ausnahmen) wie das andere.
Dahinerzähltes, auch als confessional poetry meist zu brav, zu wenig an die
Schmerzgrenze und darüberhinausgehend. Auch lakonisch oder analysierend zu
wirken, gelingt den Texten selten, dafür streben sie zu sehr voran, scheinen
irgendwohin zu wollen. Zuletzt blieb der Eindruck, Fauser wollte einfach
Gedichte schreiben, als Dokumente, als Niederschriften, und so wirken sie auch:
nur leidlich in Form gebracht oder als Text mit einer Form durchdacht.
„Was zu beschreiben bleibtwird nicht leichter weil esdas Einzige ist“
In einigen Fällen gibt es dann doch einen Zug in den
Gedichten, dessen Kraft sich aus der Aussage dieser drei Zeilen zu speisen
scheint. Dann wird das Beschriebene zur singulären (nicht beliebig wirkenden),
verdichteten Studie der Unausweichlichkeit, der Unveränderlichkeit. Fausers
Gedichte sind dort noch am stärksten, wo sie nicht einfach alles zu Fatalismus
verrühren, sondern den Fatalismus, die Geworfenheit langsam herausarbeiten. Das
geschieht meist in Gedichten, in denen Leute miteinander sprechen, in denen
Fauser seine gute Darstellung des Zwischenmensch-lichen zum Einsatz bringen
kann.
Ich wünschte, ich könnte mehr Gutes verlautbaren über
Fausers Gedichte. Ob sie vielleicht auch einfach nicht mehr zeitgemäß sind,
darüber ließe sich diskutieren, aber das will ich nicht entscheiden (und könnte
ich auch nicht) – in jedem Fall wird darin dann und wann ein Bild von Männern
und Frauen entworfen, das, wenn nicht kritisiert, so doch zumindest als
überholt bezeichnet werden könnte. Auch der Weltschmerz und die
Kamikaze-Allüren in manchen Texten wirken unfreiwillig komisch. Natürlich liegt
es mir fern, Fauser die Authentizität oder seiner Lyrik eine Wirkung auf andere
abzusprechen. Die Bedenken, die ich hier ausgebreitet habe, mögen andere
Lesende vielleicht sogar neugierig machen auf das, was Fauser zu bieten hat.
Dagegen ist nichts einzuwenden, vielleicht hoffe ich sogar darauf, dass noch
einige Leute in Fausers Gedichten etwas entdecken, das ich nicht finden
konnte.
„Staub wächst nach,durch die offenen Fensterwirft der Wind ein paar Sterne,und der Mond leuchtet wie von Sinnendurch das Flachszeltdes herbstlichen Himmels.“


