Jochen Kelter: Wie eine Feder übern Himmel
Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen
Timo Brandt
Eine Misere, das Ganze …
„Während sie drinnen am TVüber die Krise in der Ukraine talkenharte Bandagen gegen Besänftigungbeamtet geföhnt vom immer gleichenWerbewind der ErtragsmaximierungDer Lebensentäusserung schaue ichauf der monddunklen Terrasse wiedie Märzsonne spriessende Zweigeund Blätter der alten Rosenstöckebefeuert hat und bedenke ob unserSchreiben geeignet sei aus unsheraus und uns gegenüber zu treten“
Gramvoll
beginnt Jochen Kelters Gedichtband, dessen Texte den lapidaren Ton seines
Titels „Wie eine Feder übern Himmel“ nie ganz erreichen werden, auch wenn es
der Ton ist, von dem seine Gedichte ausgehen und wohin sie immer wieder zurückfinden;
doch ausfüllen tut sie immer etwas anderes, dunkleres.
Die
Gedichte des ersten Kapitels, in denen sich das lyrische Ich „allein auf dem
Grund der Zeit“ fühlt, sind jedenfalls derart trostlos, dass man den Band am
liebsten wieder zuschlagen würde. Seit César Vallejo hatte ich keine Dichtung
mehr gelesen, die sich so konsequent hoffnungslos gab, mit einem forschen und gleichsam
energielosen Zynismus bestreut.
Diese
Hoffnungslosigkeit schlägt im Verlauf des Bandes durchaus um, in Anklagen und
kämpferische Töne, hebt ihren Saum aber nie so weit, dass man sie nicht noch
rascheln hört in tristen Wendungen, in Worten wie „Lebensentäusserung“,
Bezeichnungen wie „alt“, „grau“ oder „immer gleich“.
„Durch zerborstene Wohnungenbewegen sich Verteidiger zu ihremSchutz möge Gott uns als Märtyrerfür die Freiheit zu sich nehmen nurVogelgezwitscher noch und Granaten“
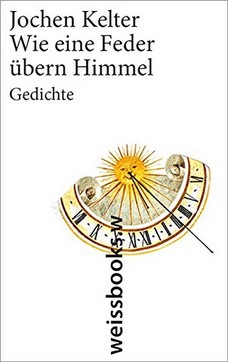
Ansonsten
finden wir uns thematisch oft an Krisenplätzen wieder, alten wie neuen.
Verschiedene Orte wie etwa Paris oder Piräus werden Schauplatz, aber auch über
den Tellerrand hinaus geht der Blick, zu den aktuellen Kriegsgebieten, zu denen
wir durch das Fernsehen eine gewisse Nähe, aber auch eine klare Distanz haben,
wie etwa Syrien oder die Ukraine.
Es ist
natürlich löblich, wenn sich ein deutschsprachiger Dichter mit diesen Themen
auseinandersetzen will – die Frage ist allerdings, wie weit man dabei gehen
sollte. Während in dem zu Anfang zitierten Gedicht über den Ukrainekonflikt die
Perspektive des lyrischen Ichs durch die Position vor dem Fernsehgerät, sitzend
und reflektierend, gekennzeichnet ist, ist es bei dem Gedicht über Aleppo und Syrien
schon nicht mehr ganz klar, ob das lyrische Ich vor Ort ist, ob es einen
Background gibt oder ob hier schlicht das Thema aufgegriffen und inszeniert
wird.
Der
dritte Teil des Bandes, „Nach Piräus“, beginnt mit einem Gedicht, dem ein Zitat
von W. H. Auden vorangestellt ist:
„For nothing nowcan ever come to any good“
Ein
Zitat aus dem mittlerweile wohl bekanntesten Gedicht von Auden, dem neunten der
„Twelve Songs“, ursprünglich geschrieben als (satirisch intonierte) Hymne eines
glühenden Verehrers für seinen verstorbenen Diktator; dank des Films „Vier Hochzeiten
und ein Todesfall“ wird das Gedicht mittlerweile als Gesang an eine verlorene
romantische Liebe wahrgenommen.
Kelters
Gedicht, das auf dieses Zitat folgt, heißt „Sommer einundvierzig“ und skizziert
Bilder von einmarschierenden Wehrmachtsoldaten und Massenerschießungen. Die
letzte Strophe lautet
„Ab hier war jeder schuldigder nicht schon geflohen verhaftetins Lager zu Tode gekommen warzerschlagen zertrampelt zerstörtvor dem Sommer der Bestien“
Wo kommt
das auf einmal her, wieso dieser Urteilsspruch (eines Nachgeborenen, Kelter
wurde 1946 geboren)? Natürlich sind die entsetzlichen Greul, die Hitlers
Soldaten beim Einmarsch in die Sowjetunion begingen, bis heute Grund zu warnen,
zu mahnen, nachdrücklich und lückenlos zu schildern – und es ist auch wichtig,
klarzustellen, dass viele Soldaten Zivilisten exekutierten, es also eine sehr
große Anzahl von Tötungen gab, die nichts mit Kampfhandlungen zu tun hatten.
Aber
diese letzte Strophe – sie überhebt sich, im doppelten Sinne. Nicht nur, weil
sie die unfassbaren Verbrechen in allzu dramatische Worte packt und dabei
vergisst, wie schwierig es manchmal ist, Dimensionen mit Wörtern zu benennen,
und dass man folglich oft besser beraten ist, sie anzudeuten, Exemplarisches
anzuführen – sondern auch weil der Dichter sich in die Rolle eines Richters
erhebt, eine Rolle, für die er keine Voraussetzungen mitbringt und auf die man
als Dichter, so finde ich, auch keinen Anspruch erheben sollte. Obwohl ich
eigentlich verstehe, welche engagierte Prägung Kelter gerne seinen Gedichten
verleihen will (was ihm dann und wann auch gelingt, so z.B. in einem Gedicht,
wo er an die Mitschuld der Kirche im Ruanda-Konflikt erinnert – „erinnert“ und
nicht darauf herumreitet).
Dieser
Wunsch übersteuert manchmal seine Gedichte und schon wirken sie überzogen und
drastisch, obwohl sie es strenggenommen gar nicht sind.
Alles in
allem ist dieser Band voller kluger Einschübe und rüstiger Verse. Etwas zu
selten lässt Kelter meiner Meinung nach Nachdenklichkeit, etwas Zartes oder
Feines, zu, geht strikt seinen Weg auf wohlgefeilten Zeilenstufen, die aber
manchmal etwas eindimensional wirken. Liest man manche Gedichte mehrmals, ist
man richtig gehend überrascht, wie viel in ihnen steckt.
Man muss
ein bisschen Geduld mitbringen. Dann gelingt hier und da Erhellendes,
Wichtiges, Unverstelltes.
„dem grauen Leben und denwenigen Goldkörnern schreibeWorte wie Schnee und wie Taudie fallen und wieder vergehen“
Jochen
Kelter: Wie eine Feder übern Himmel. Frankfurt a.M. (Weissbooks) 2017. 128
S.16,90 Euro.


