Hendrik Jackson: Wiedergefunden: Die Blätter der Heiligen von Paul Claudel
Memo/Essay > Aus dem Notizbuch > Essay
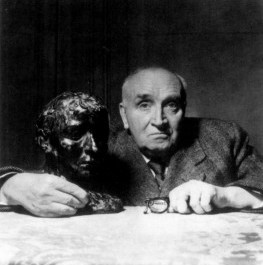
Hendrik Jackson
Wiedergefunden:
Die Blätter der Heiligen von Paul Claudel
Blätter der Heiligen. Kaum las ich den Titel, hört ich schon brüchiges Pergament blättern, Laub rascheln, Lichtungen im Dickicht des Lebens Mitte sich auftun. Ich fand diese Blätter in Paris in einem Antiquariat und sie klangen verheißungsvoll. Schon lange wollte ich etwas von Paul Claudel lesen. Doch mein Französisch war dürftig. Ich begann, schlug immer wieder Vokabeln nach, erschöpfte. Nichtsdestotrotz mochte ich es, das Buch herumzutragen, seine Zeit kommen zu spüren. Erst Monate später, an einem brütend heißen Mittagswahnsinn in Barcelona, ich hatte meine Kamera gerade verloren, oder sie war gestohlen worden, saß ich erschöpft im Schatten auf einer Bank, in einem toten Winkel der Stadt, plötzlich wie befreit: Ich nahm dies alte mürbe Buch in die Hand und verstand, wie mir schien, jedes Wort (statt äußerer, zufälliger Fotos nun: innere Bilder). Obwohl ich immer noch mehr als ein Drittel der Wörter nachschlagen musste. Das Buch auf meinen Knien. Hitze. Ein Glücksgefühl, und das wuchs zu solch immenser Ausdehnung, dass ich dachte: das kam auch von seinem Glauben an die Wörter, an die Sprache her, Sprache des Trostes. In solchen Blättern der Heiligen zu blättern, bedeutet Balsam fürs geschundene Ich.
Nicht nur aufgrund der vielen Titel von mutigen, glühend beseelten Männern und Frauen (von Rimbaud bis zum heiligen Georg), der schönen Legendenanfänge, der poetischen Sentenzen, ja, der Grundanlage des Bandes in seiner Absolutheit, Unbedingtheit, sondern weil sich in diesen so leicht daherkommenden, so unauffällig aber pointiert gereimten Langversen eine Sehnsucht und ein schier berstendes Hoffen eingenistet hatte, wie es uns (Säkularen) völlig abhanden gekommen ist.
Eines der schönsten Gedichte des Bandes, das ich gleich zu übersetzen begann, endet in Anmut und Glorie, Saint Colette: "Quatre ou cinq femmes et paysans à la file, et Colette la première sur son âne qui regarde Dieu." Wer sieht hier wen? Colette sieht ihren Gott? Aber vorher hieß es noch über sie: "qui ne sait absolument ce qu'elle fait"?
Passt das – oder ist es der Esel, Christussymbol, der als einziger noch Gott sieht, unwissend, unschuldig? Oder sieht Gott den Esel, ist er doch Symbol seines gekreuzigten Sohnes? Oder verschmelzen etwa alle drei Perspektiven in Dreieinigkeit der Einfältigkeit?
Mittendrin in einer anderen Welt des Glaubens, einer Welt der Anrufungen und inwendigen Symbiosen.
Es kam das Jahr 2017 und damit der Buchmessenschwerpunkt Frankreich. Viele Autoren wurden entdeckt und publiziert, aber eben an diesem Paul Claudel, der es mehr als alle anderen verdient hätte, gab es kein Interesse.
Zwei große, gestisch sehr bestimmt, wenn nicht autoritär auftretende Lyriker hat Frankreich hervorgebracht im 21. Jahrhundert, die beide voll Pathos sind und voll (angreifbarer) Akklamationen. Einer (eher) revolutionär-rebellisch, der andere (eher) konservativ-bewahrend, Kämpfer im Widerstand der eine, Diplomat, streitbarer Katholik der andere – René Char und Paul Claudel.
Sie könnten kaum gegensätzlicher sein. Und doch finden wir bei beiden ein nicht unähnliches Glühen von Grundüberzeugungen, bei beiden einen innigen, sowohl überhöhten wie auch tröstenden Ton der Anrufung, einen Kampf der Ausrufezeichen, eine endlos variierende Umkreisung wiederkehrender Themen bei gleichzeitigem Streben nach Prägnanz und Vehemenz. Gleichzeitig überbordende Sprache voll Pathos, als auch voll Strenge und Zurücknahme, als wären sie in ein größeres Sein einfach hineingestellt worden und formten ihre Poesie aus einem anfänglichen Stammeln heraus neu: René Char indem er in fragmentartigen, rätselhaften Sinn- und Bildsprüchen aufflammt, die den Mut stärken und die Redlichkeit des Widerstands stählen sollen, Paul Claudel, indem er sich diszipliniert und die Sprache ordnet zu langzeiligen Hymnen, so die Verklärungen seines Herzens ausseufzend.
René Char hatte seine Zeit, es brauchte gegen den Faschismus einen starken, tapferen Geist, und er gab dem Widerstand seine Lyrik. Hingegen Paul Claudel schien lange Zeit aus der Zeit gefallen. Sein orthodoxer Katholizismus, seine endlosen Exkursionen voller theologischer Referenzen schienen niemanden mehr etwas anzugehen.
Doch wer, wenn nicht ein spirituell inspirierter, suchender Mensch, und sei er auch Katholik, könnte die seelischen Dimensionen begreifen in dem, was zur Zeit vor sich geht? Die praktischen, ökonomisch-geopolitischen Zusammenhänge werden massenhaft beleuchtet, während die Folgen für die innere Integrität, die geistige Dimension des Menschen nur in dürren Annäherungen, hilflosen Porträts mehr verschleiert als ausgeleuchtet werden.
Die Linke hat sich nach Kräften selbst demontiert, diskreditiert, angreifbar gemacht. Sie ist unendlich schwach geworden. Die Zeit der großen autoritären oder utopischen Figuren ist vorbei (Adorno, Lenin, Luxemburg – aber eben auch lyrisch: Char, Majakowski, Brecht).
Die "Rhizombildungen" oder intelligenten Schwärme, in die so viel Hoffnung gelegt wurde, zermürben sich in Randgruppenkämpfen und Kasusgerechtigkeitsscharmützeln. Das große Andere ist aus den Augen geraten, verloren in der Depression nach der vollendeten säkularen Ernüchterung. Eine auf Blockwartakribie zusammengeschnurrte Vorstellung von Gerechtigkeit, die permanent jeder Kränkung nachgeht, kann den wirklich Benachteiligten keine erlösende Alternative und den nach Utopien Dürstenden keine Vision mehr bieten. Die Versöhnungen und Gerechtigkeiten bleiben dabei den bereits Etablierten vorbehalten, orientieren sich an Interessen Privilegierter, global gesehen.
Ein katholischer Glaube wie der Claudels erinnert an die gütigen Seiten dieser Religion. Seine Argumente und Bilder könnten, um ein Beispiel zu nehmen, vielleicht sogar besser als die säkularer Pragmatiker, einen Gegenpol bilden zu religiösem Fanatismus, der doch immer das Religiöse der Religion verrät, nicht nur durch den Hass, den er sät, sondern vor allem, weil er die Sünde der Hybris, der Gottesanmaßung auf sich lädt. Wer aber im Namen der Liebe spricht, braucht keinen Kreuzzug gegen Ungläubige oder Gläubige, im Gegenteil. Was wir neben Aufklärung und Vernunft brauchen, wäre auch eine Rückkehr der Beseeltheit, die Respekt vor allem Lebendigen hat. Aussöhnung der Vernunft mit liebender Hingabe, denn die Vernunft, darauf weisen katholische Denker unermüdlich hin, hatte schon immer eine kalte, aussortierende Seite.
In dem absolut großartigen Gedicht "Der heilige Joseph" aus den "Blättern der Heiligen" heißt es: "Es ist nicht mehr der nackte Glaube in der Nacht, die Liebe ist jetzt das Wirkende und der Berater. (...) Aber auch uns, damit wir Gott endlich zulassen, dessen Werk unsere Vernunft übersteigt, // Damit sein Licht nicht durch unsere Lampe gelöscht sei, da Sein Wort unseren Lärm überschweigt". Oder, in dem Gedichtzyklus "Corona Benignitatis Anni Dei": "Der Häretiker kann nur gewaltsam zerbrechen, trennen und weitertrennen in neuen Rissen", er kehrt ins "tonlose Chaos zurück". Dagegen setzt Claudel den Ruf des Herzens aus der Verzweiflung: "Nicht die Lanze öffnet in Gottes Mauer den Spalt, / sondern der Schrei des bedrängten Herzens, denn das Himmelsreich leidet Gewalt".
Dabei schreibt Claudel allerdings nicht nur haarscharf an der Kitschgrenze entlang, oft auch drüber hinaus. Das bringt uns zu dem Problem der Übersetzung.
So schön fließend die einzig antiquarisch zu erwerbende Übersetzung von Urs von Balthasar auch sein mag und so großartig sie in der Findung von Reimen und im sanften Ton des Pathos ist, so sehr geht ihr doch jene letzte Prägnanz ab, die die Sprache des Originals so unbestechlich macht, so klar, so schlicht eben wie Joseph in seiner Bestimmung: gleichzeitig demütig und weltumspannend in seiner religiösen Zeugenschaft, geweitet durch Gott. Wichtig ist bei einer Übersetzung Claudels, dass jede Nuance passt oder ergreift. Immer wieder muss die Sprache auf Schlichtheit, bei allem Pathos, rückgeführt werden. Balthasar gelingt das oft, aber noch öfter bekommt es etwas zu Hehres, Getragenes, das die Zeilen letztlich in ihrem Innersten bedroht.[1]
Man muss das zunächst einmal auf französisch hören, auch diese seltsamen kleinen Satzinversionen, diese fast lehrhaften, aber eben aus einem Schmerz sprechenden Vorausstellungen des Subjekts ("sie ist es, die", "er ist, der", wie um sich zu versichern, dass jeder, jede der Gnade würdig ist), die Raum schaffen für Wahrheiten, die nur die gelungene Poesie so aussprechen kann. Dann sind viele der Claudelschen Sätze Pfeile, die ins Innerste poetischer Sprache treffen und die in ihrer ergreifenden Schlichtheit fast unvorstellbar geworden sind.
Aus dem genannten Gedicht über den "heiligen" Joseph zum Beispiel: "Comme jadis quand il était jeune garçon et qu'il commençait à faire trop sombre pour lire, // Josephe entre dans la conversation de Dieu avec un grand soupir."
Nein, Joseph spricht nicht mit einem Gott, er tritt in das Gespräch des Gottes, vom Gotte ein. Er tritt in diesen Prunksaal voll widerhallender Stimmen und findet dort ein Seufzen aus dem tiefsten innersten Grund des Herzens.
Selten haben zwei Zeilen mehr Kreuzeserfahrung und zugleich Verheißung in sich getragen. Fast noch größer im genannten Gedicht "Sainte Colette": "Pour la reclure désormais, plus besoin de cet oeuf de pierre, // Elle est libre dans la sel, elle est ensevelie dans la lumière!"
Was wird hier alles aufgerufen, um es in einem unendlich hoffnungsvollen Ausrufezeichen zu befrieden. Immer wieder gelingen Claudel Sätze von Weite und Trost, die der Krankheit zum Tode entspringen, sicherlich – aber wie weit muss man gegangen sein, um so sprechen zu können.
Vielleicht ist die Zeit solcher Anrufungen vorbei. Vielleicht ist das Progressive eben in anderen Denkungsarten: rhizomierten, dezentralisierten Konzepten (nicht zufällig verherrlicht Claudel dagegen, "römisch gepolt", den Kampf um Frankreich, Jeanne d'Arc als eine die Nation einigende Heilige), nicht in Glaube, Pathos und Inwendigkeiten, sondern bei Ironie, Wissenschaft und Anthropozänkritik zu finden. Vielleicht sind sowohl der so männlich auftretende Partisan Char als auch der vermeintlich weiche, aber ultrakonservative Diplomat Claudel Auslaufmodelle. Aber was bedeutet schon „Auslaufmodell“ in einer Welt, in der der Beseeltheit und Güte nie genug sein kann und deren technischer Fortschritt doch seit jeher von ungebrochener rücksichtsloser Primitivität[2] flankiert wurde.
Dabei sollte Claudels Werk weder auf eine Leidensliebesmystik, so sehr sie allem Frustfaschismus entgegen stünde, noch auf seinen Katholizismus reduziert werden. Auch wenn Claudel durchaus auf simplifizierende Dogmen oder konfessionelle Phrasen rekurriert, Auffangbecken für die Seele anbietet, ist er sich der Gefahr konfessionell gebundener Literatur bewusst und versucht sie zu meiden.[3]
Claudel als Poet, der den Fuß auf den Fels des Glaubens setzt, der unbeweglich in die Ewigkeit schaut – ihn lassen wir so in der Vergangenheit stehen, Bild einer anderen Zeit – aber die Claudelschen Heiligen als sich schier Verzehrende, verzweifelt Leidende und ihre Bilder und Embleme, in denen nicht nur die Naivität der Gutgläubigkeit schlummert, sondern die Milde derer, die durch die vollkommene Absenz von aller Zuversicht gingen, in Gottverlassenheit – sie nehmen wir mit in die neue, drängendste Zeit: "Une porte, une porte, ô mon âme, une porte pour sortir de l'éternelle vanité ! (...) une porte pour échapper / A cette vie qui n'est qu'un rêve lourd, un cauchemar entre les deux digestions!"
Wo die Gläubigkeit der Heiligen Claudels und sein genaues literarisches Schauen übereinkommen, haben seine Verse ihre lichten Momente, gleißt seine Poesie auf eine Weise, die für einen Moment jede andere Literatur schwärzt und blind für agnostische, letztlich orientierungslose Dichtung macht. Führt so eine religiöse Literatur also in eine Art von Verblendung? Mag sein, doch viel Wahl und Zeit haben wir nicht: "Quand on est en péril de mort / toutes les armes sont bonnes pour se défendre."
[1] Was soll man zum Beispiel davon halten, wenn aus "ainsi qu'un appareil de désir // Continuellement occupé à respirer pour ne pas mourir" folgende, zwar originell gereimte, aber doch ein bißchen, um des Übersetzers eigenes Wort zu nehmen: aufgeblasene Version wird: "eine Art von Sehnsuchts-Gebläse, // Mit unablässigem Atem bemüht, daß es nicht verwese,". Moderner könnte man hier fast mit deleuz'schen Begriffen erst einmal wörtlich übersetzen: „wie eine Wunschmaschine, // immerzu genötigt zu atmen, um nicht zu sterben“ – und es hätte zumindest nichts Antiquiertes mehr.
[2] … wenn nicht zunehmend sogar von ihr dominiert wurde oder sogar Hauptmovens des Fortschritts ist. Man denke an das 20 Jahrhundert oder z.B. an die Untersuchungen des Ethnologen H.P. Duerr, der versucht hat, nachzuweisen, dass die moralischen Kontrollinstanzen des Zusammenlebens in den „Zivilisationen“ noch geschwächt wurden, hingegen rein technisch-etatistische obsiegt haben und totale Enthemmung erst möglich machten.
[3] so schreibt er in dem Gedicht Sainte Thérèse: "Et ce monde hermétique muré (...) / Nous est décrit avec des mots repris et repressés par un milliard de sermons, / Entrecoupés d'éjaculations à froid (...)"
Zur Übersetzung von "Sainte Colette" »


