Gunnar Sohn: Der Schnitt der Vernunft
KIOSK/Veranstaltungen > Veranstaltungen
0
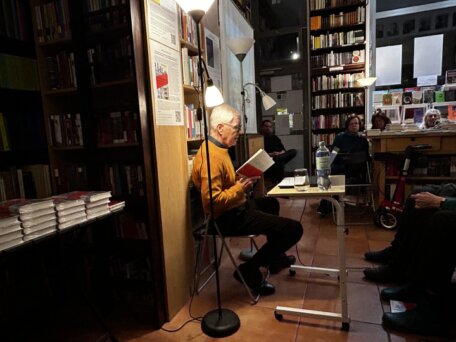
Gunnar Sohn
Der Schnitt
der Vernunft
László F. Földényi über Paris, die
Guillotine
und den Traum der Surrealisten
Ein Mädchen
mit Fernrohr
Es beginnt mit einem Mädchen, das ein Fernrohr in der
Hand hält. Hinter ihr steigt ein Ballon, daneben schwebt ein Fallschirm. Ein
Bild des jungen Ingres, gezeichnet um 1797: Barbara Bansi, Tochter einer Genfer
Emigrantenfamilie, blickt in den Himmel – in eine Zukunft, die heller scheint
als sie ist. Ein Blick, noch unschuldig, aber schon durchdrungen von der
Faszination des Messbaren. Der Ballon hebt ab, der Mensch fällt – und zwischen
beiden Bewegungen beginnt die Moderne.
László F. Földényi erzählte diese Geschichte in der
Buchhandlung Böttger in Bonn. Kein akademischer Vortrag, sondern ein leises,
gedankensattes Pariser Nachtstück, durchzogen von Ironie und Melancholie.
Alfred Böttger begrüßte den Gast mit jener
unnachahmlichen Mischung aus Gelehrsamkeit und Witz, die diese Buchhandlung zu
einem Ort des Denkens macht. „Fast alle seine Bücher stehen in meinem Fenster“,
sagte er, und es klang weniger nach Werbung als nach Freund-schaft.
Die
Humanität der Klinge
Földényi beginnt mit der Erfindung einer Maschine, die
das Töten humanisierte. So jedenfalls verstand es Dr. Joseph-Ignace Guillotin,
als er im Herbst 1789 in der französischen Nationalversammlung den Vorschlag
machte, alle Hinrichtungen künftig mit einem einheit-lichen, mechanischen Gerät
durchzuführen – schnell, schmerzlos, gleich für alle.
Die Guillotine war das erste technische Symbol der
Gleichheit. Kein Henker mehr, keine Tortur, keine soziale Hierarchie im Tod.
Der Fortschritt kam mit einer Klinge. Und mit ihm die Illusion, dass sich Moral
und Mechanik versöhnen ließen.
Földényi erzählt von der eigentümlichen Faszination,
die das Gerät im 19. Jahrhundert ausübte: wie Spielzeug-Guillotinen in
europäischen Salons kursierten, mit denen Kinder Puppen enthaupteten. Selbst
Goethe, der von allem Technischen magisch angezogen war, wünschte sich für
seinen Sohn August ein solches Modell. Die Großmutter verbot es. Vernunft hat
manchmal Mütter.
Experimente
mit dem Tod
Nach der Revolution begann die Wissenschaft, das
Werkzeug des Scharfrichters als Laborinstrument zu betrachten. Ärzte,
Physiologen, neugierige Gelehrte beobachteten die abgeschlagenen Köpfe:
Blinzelten sie noch? Zuckten die Lippen? Reagierte das Bewusstsein für
Sekundenbruchteile weiter?
Földényi zitiert Berichte aus den Zeitungen jener
Jahre: wie die Augen der Toten die Blicke der Umstehenden erwiderten, wie ein
Arzt dem abgetrennten Haupt eines Verurteilten seinen Namen zurief – und das
Gesicht, so wurde berichtet, sich für den Bruchteil einer Sekunde empörte.
Die Guillotine wurde so zum Vorläufer der modernen
Neurowissenschaften, ein makabres Experimentierfeld der Aufklärung, in dem man
glaubte, den letzten Rest von Bewusstsein messen zu können. Der Schnitt als
Methode der Erkenntnis.
Vom Schafott
zum Atelier
Hier setzt Földényi seine geistige Verbindungslinie.
Die Präzision des Scharfrichters wird zur Geste des Künstlers. Der Schnitt, der
Körper trennt, kehrt als Kompositionsprinzip in die Kunst zurück.
Die Surrealisten, hundert Jahre später, übernahmen
diese Logik – aber sie wendeten sie um. Wo die Guillotine den Menschen
spaltete, setzten sie ihn wieder zusammen: aus Träumen, Fundstücken, Brüchen,
Zitaten. Lautréamont sprach von der „zufälligen Begegnung einer Nähmaschine und
eines Regenschirms auf einem Seziertisch“ – ein Bild, das die Grausamkeit der
Mechanik in den poetischen Wahnsinn der Assoziation überführt.
Bei Földényi bekommt dieser Satz Gewicht. Die
Guillotine, sagt er, war die erste Maschine, die das Denken in Schnitte
übersetzte. Die Surrealisten, von Apollinaire über Max Ernst bis zu Buñuel,
machten aus diesen Schnitten ihre Grammatik.
Inkohärenz
als Methode
In seiner Lesung beschreibt Földényi mit spürbarer
Freude die Vorläufer des Surrealismus: die „Inkohärenten“, eine anarchische
Künstlergruppe im Paris der 1880er-Jahre. Ihre Ausstellungen trugen Titel wie Zeichnungen
von Menschen, die nicht zeichnen können. Zweitausend Teilnehmer reichten
Werke ein – schwarze Leinwände, weiße Leinwände, betende Schweine, zerlegte
Körper, Karikaturen des Ernstes.
Es war die Ästhetik des Zufalls, des Dada avant la
lettre. Die Jury loste die Preise aus. Der Spott wurde zur Methode, der Unsinn
zur Erkenntnis. Földényi beschreibt diese Bewegung als „humoristische
Wiederkehr der Revolution“: Wo Haussmann mit Lineal und Dekret Ordnung schuf,
zersägten die Inkohärenten die Welt in Stücke – und lachten darüber.
Ihre Nachfahren sind die Surrealisten. Was in der
Guillotine begann – die Idee, dass Erkenntnis durch Trennung entsteht –, endet
in Collage und Montage, in Lautréamonts, Duchamps, Arps und Richters Welt.
Die Anatomie
des Traums
Die Guillotine schnitt den Körper, der Surrealismus
schnitt die Sprache. Beide suchten das Unbewusste, das im Moment der Trennung
aufblitzt.
Apollinaire, sagt Földényi, war der Chronist dieser
Umkehrung: Seine „Calligrammes“ ordnen Wörter wie Körperteile, die sich
auflösen und neu zusammensetzen. Bei Proust wird die Erinnerung zur sanften
Guillotine – ein Akt der Zergliederung, der Liebe, der Zeit. Lautréamont und
Rimbaud treiben den Schnitt ins Visionäre: das Denken als Enthauptung der
Gewissheit.
So entsteht eine doppelte Bewegung – die Aufklärung
schafft das Messer, der Surrealismus verwandelt es in ein Werkzeug der
Imagination.
Epilog:
Bonner Surrealismus
Als Alfred Böttger am Ende das Wort ergreift, klingt
die Geschichte wie eine Variation über Paradoxien. „Ihr enzyklopädisches Wissen
erschlägt mich nicht, es erfreut mich“, sagt er. „Ich bekomme Lust,
weiterzudenken.“ Und dann fügt er hinzu, ganz Kaufmann und Philosoph zugleich:
„Wenn Sie noch einmal ins Buch schauen, werden Sie es kaufen. Und wissen Sie,
was dann passiert? Sie machen mich reich – und, viel schöner, Sie machen sich
selbst reich.“
Das Publikum lacht. Draußen regnet es über Bonn, als
habe sich ein Hauch von Pariser Melancholie in die Nacht verirrt.
Vielleicht, denkt man, war die Guillotine nur der
Auftakt einer geistigen Revolution, die noch immer andauert – der Versuch, in
jedem Schnitt einen Gedanken zu finden, in jeder Wunde ein Bild, in jeder
Unterbrechung ein neues Beginnen.
Barbara Bansi hält ihr Fernrohr in der Hand. Der
Ballon steigt, der Fallschirm sinkt. Zwischen beiden – die Schwebe des
Bewusstseins.
Denken, sagt Földényi, ist vielleicht nichts anderes,
als den Fallschirm nach dem Fall zu erfinden.
László F. Földényi: Der lange
Schatten der Guillotine. Lebensbilder aus dem Paris des neunzehnten
Jahrhunderts. Deutsch von Ákos Doma. Berlin (Matthes & Seitz) 2024. 302 Seiten, 28,00 Euro.



