Felix Philipp Ingold: Im stalinistischen Literaturbetrieb
Memo/Essay > Aus dem Notizbuch > Essay
0
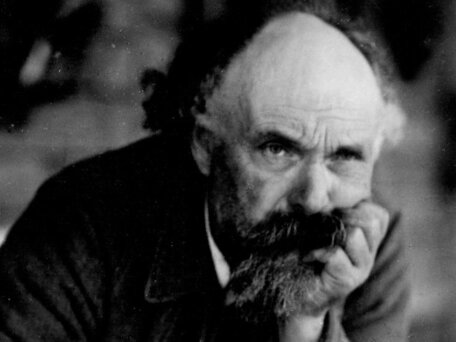
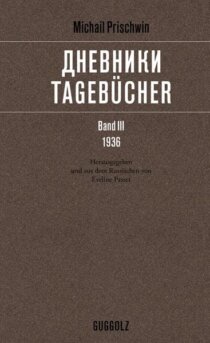
Felix Philipp Ingold
Im stalinistischen Literaturbetrieb
Michail Prischwin berichtet von Anpassung und Widerstand
Beiläufig notiert
der russische Schriftsteller Michail Prischwin in seinem Tagebuch für das Jahr
1936, er habe den «letzten Zahn» verloren und müsse sich nun wohl um ein
künstliches Gebiss bemühen … Mit diesem trivialen, für ihn aber offenkundig
bedeutsamen Eintrag verweist er indirekt auf sein vorgerücktes Alter (63),
andrerseits – symbolisch – auf seine damalige Lebens- und Arbeitssituation, in
der er angesichts der zunehmenden stalinistischen Repression manche
persönlichen Wertvorstellungen aufgeben und sich literarisch wie ideologisch
völlig neu positionieren musste, um weiterhin im sowjetischen Kulturbetrieb
bestehen zu können.
Die behördliche Reglementierung der
Sowjetliteratur, ihre ideologische Vereinnahmung wie auch ihre «Säuberung» von
angeblich staats- oder parteifeindlichen «Elementen» hatten bereits in den
frühen 1930er Jahren eingesetzt, ehe sie um 1936 zu systematischem Staatsterror
mutierten. In Moskau fand damals ein erster Schauprozess statt, der mit der
Erschießung namhafter stalinkritischer Parteifunktionäre endete. Gleichzeitig
wurde ein neues Grundgesetz verabschiedet, das als «Stalin-Verfassung» gelten
sollte. Durch zusätzliche Verordnungen zur Familien-, Arbeits-, Gesundheits-
und Hochschulpolitik verschärfte der Kreml die soziale Disziplinierung.
Ebenfalls 1936 gerieten
namhafte Kulturschaffende wie der Komponist Dmitrij Schostakowitsch oder die
Dichter Demjan Bednyj und Boris Pasternak wegen formaler und ideologischer
Abweichungen vom offiziell dekretierten Sozialistischen Realismus in den Focus
der Parteikritik. Eine kleine dissidente Minderheit zog sich unter diesem
massiven Druck ins innere Exil zurück und verharrte für lange Zeit in
unfreiwilligem Schweigen – Bulgakow, Olescha, Tynjanow und Anna Achmatowa
gehörten, nebst andern, zu dieser verstummten Elite.
•
Mit dem Tod Maksim
Gorkijs im selben Jahr verlor die gleichgeschaltete Sowjetliteratur einen
einflussreichen Moderator: Als Vorsitzender des nationalen
Schriftstellerverbands und als langjähriger Vertrauter Stalins hatte er sich
wiederholt für bedrängte Autoren eingesetzt, indem er ihnen – wenigstens – zu
Strafmilderungen oder zur Emigration ins Ausland verhalf. Doch Hunderte von Schriftstellern,
Publizisten, Übersetzern, Literaturkritikern und -profes-soren wurden
in der Folge festgenommen und hingerichtet; Tausende von Intellektuellen aller
Sparten kamen in Lagerhaft; nur linientreu engagierte Literaten behielten die
Möglichkeit, ihre entsprechend begradigten Texte «offiziell» zu veröffentlichen
– das Verlagswesen, die Presse, der Literaturbetrieb insgesamt waren
verstaatlicht. Viele willfährige Literaten – auch sie scharf beobachtet –
konnten damals unter besten materiellen Bedingungen weiterarbeiten und
publizieren.
Zu ihnen gehörte
auch der angesehene, schon vor der Revolution populäre Erzähler Michail
Prischwin, der sich als versierter Verfasser von Reise-, Volks-, Natur- und
Kinderliteratur einen Namen gemacht hatte. Mit seinen ersten Werkausgaben (3
Bände, 1912-1914; 7 Bände, 1927-1930) etablierte er sich als künftiger Schulbuchklassiker
der russischen literarischen Moderne, zog aber mit seiner Naturseligkeit
(«Biologismus») auch Kritik auf sich. Titel wie «Der Vogelfriedhof» (1911), «Das
Jüngste Gericht» (1917), «Die Kette des Kastschej» (1927), «Shen-Schen» (1933) festigten
seinen Ruhm.
Ungeachtet
seiner früheren und aktuellen Vorbehalte gegenüber der bolschewisti-schen Kulturpolitik
versuchte Prischwin nach dem Großen Oktober in der Sowjetliteratur Fuß zu fassen.
Das ließ sich ohne entsprechende Zugeständnisse und Kompromisse nicht
bewerkstelligen. Durch geschicktes Lavieren gelang es ihm, seine prominente
Stellung im Literaturbetrieb zu wahren, sie sogar zu erweitern und sich darüber
hinaus diverse rare Privilegien zu sichern. Als ordentliches Mitglied des
Allsowjetischen Schriftstellerverbands hielt er dort wie in andern offiziellen
Gremien seine obligaten Reden, beklatschte die Auftritte wortführender
Funktionäre, meldete sich in der Partei- und Regierungspresse regelmäßig zu
Wort, unternahm in deren Auftrag diverse Informations- und Studienreisen, um
die Errichtung der neuen stalinistischen Ordnung, speziell auch der forcierten
Industrialisierung zu beobachten und darüber zu berichten.
Während eine
Vielzahl seiner Kollegen Gefangenschaft oder Verbannung erdulden mussten,
genoss Prischwin ungewöhnliche, geradezu exzentrische Privilegien: Bei völliger
Bewegungsfreiheit konnte er seinen Wohnort nach Belieben wechseln, wurde mit
luxuriösen Nahrungsmitteln versorgt, besaß einen Privatwagen, eine
professionelle, aus Deutschland importierte Photoausrüstung (Leica! Zeiss!),
dazu eine Lizenz zum Jagen, die er auch während der Terror- und Hungerjahre
ausgiebig nutzte – seine Tagebuchaufzeichnungen von 1936 (und generell aus den
1930er Jahren) geben darüber reichlich Auskunft.
Auf einer
mehrmonatigen Dienstreise durch den Nordkaukasus, die er im Auftrag der
Regierungszeitung «Iswestija» absolvierte, traf Prischwin wiederholt mit einem
dortigen Parteiführer (dem «lokalen Stalin») zusammen und glaubte in ihm den
Typus des kommenden Machthabers zu erkennen – einen Menschen mit «rein
kindlichem Bewusstsein von Recht und Wahrheit», mit unbeugsamem Willen und
klarer Entschiedenheit: «Das ist rot, das ist weiß, Rot ist das Unsrige, Weiß
ist ohne Zaudern zu erschlagen. Und er macht es uns vor, geht voran. Und wir
alle werfen, seine Wahrheit spürend, unser Zaudern ab, froh ob der Möglichkeit,
unsre Seele zu reinigen.» Genau so hätte Prischwin auch sein eigenes Verhältnis
zur stalinistischen Führung beschreiben können. – Dennoch finden sich in diesen
«dienstlichen» Notizen auch Belege dafür, dass er die angeblich «lichte»
Sowjetrealität doch auch durch behördliche Fehlleistungen und Missstände
getrübt sah.
•
Wenn Michail Prischwin
kein aktiver Mitmacher des stalinistischen Gewaltregimes war, ein Mitläufer und
Profiteur war er allemal. Eindrücklich bezeugt sein Tagebuch, wie genau er die offizielle
Presse verfolgte – er registrierte jede Rede, jedes Dekret und jedes Verdikt des
Diktators, versuchte zu verstehen und zu rechtfertigen, was damit «gemeint»
war, notierte sorgsam, was führende Literaturfunktionäre und Kritiker verlauten
ließen, hielt fest, was die kommunistische Propaganda an Zielvorstellungen und
Forderungen vorgab.
Angesagt war in
der durch und durch tribunalisierten sowjetischen Gesellschaft ein «heiteres
Leben», Stalin tat es von Plakatwänden und auf Pressephotos millionenfach durch
sein «väterliches Lächeln» kund. Prischwin glaubte darin ein ingeniöses
«taktisches Verfahren» zu erkennen, stimmte also wesentlich mit Stalin überein
und warnte darüber hinaus davor, ob der verordneten Heiterkeit den innern Feind
zu vergessen: «Da es den Feind gibt, müssen die Führungsleute ihre Augen und
Ohren offenhalten, um im richtigen Moment dem Feind mit gesträubtem Fell
entgegenzutreten.»
Gelegentliche
Bedenken oder Zweifel unterdrückte Prischwin nicht, ließ sie jedoch, ohne sie
zu vertiefen, nur am Rand aufkommen. Vorrangig war er an der Durchsetzung
seines eigenen Werks und an der Bestätigung seiner literarischen Meisterschaft interessiert.
Dass er trotz der internationalen politischen Isolierung seines Landes als
einer der wenigen Sowjetautoren weiterhin im westlichen Ausland gedruckt und
gelobt wurde, schmeichelte seiner Eitelkeit – mehrfach hält er dies im Tagebuch
fest, indem er selbstgewiss bekräftigt: «Die Bedeutung meiner Stellung wird
erstens durch die Bedeutung des Kommunismus in der gegenwärtigern Zeit
bekräftigt und zweitens durch die gesellschaftliche Anerkennung meines
Schaffens.»
•
Breiteren Raum
nehmen demgegenüber Prischwins Betrachtungen und Reflexionen zur urtümlichen
russischen Natur ein (Wälder, Gewässer, Gebirge), seine detaillierten
Beschreibungen von Landschaften, Pflanzen, Tieren weisen ihn als einen
bemerkenswerten Repräsentanten des modernen Nature writing aus und
lassen im Übrigen seine Nähe zur einheimischen Folklore und Mythologie
erkennen. Er selbst setzt sich nach eigenem Bekunden zum Ziel, «volkstümlich»
und «verständlich» zu erzählen, «wie es verlangt wird», eine
Schreibweise, «die der Gegenwart gerecht wird und bei allem Realismus sich ins
Märchenhafte wendet». Im Tagebuch praktiziert er diese Erzählweise allerdings
über weite Strecken auf bestenfalls journalistischem Niveau und langweilt mit
ebenso umständlichen wie unergiebigen Beschreibungen irgendwelcher Alltags-
oder Naturphänomene.
Andrerseits ist
man erstaunt darüber, dass er geistige oder gar geistliche Dinge bloß nebenbei
anspricht, obwohl er bekannterweise philosophisch wie religiös seriös
interessiert war. Auch die literarische Klassik (deren Relevanz in Notzeiten
gemeinhin zunimmt) scheint Prischwin in seinem düsteren Berichtsjahr nicht
sonderlich beschäftigt zu haben, ausgenommen Lew Tolstoj, dessen späte
Tagebücher er regelmäßig mit Respekt konsultiert. Umso ausführlicher verbreitet
er sich über die zeitgenössische, intellektuell wie künstlerisch unbedarfte
Sowjetliteratur, wiewohl er sie merklich verachtet und widerwillig zur Kenntnis
nimmt; doch offenkundig zieht er sie als Vergleichsmaterial heran, um seinen
eigenen literarischen Spielraum auszuloten.
Dabei gerät ihm
die Auseinandersetzung mit seinem erfolgreichen Kollegen Samuil Marschak, den
er als bösartigen Rivalen wahrnimmt, zu einer intimen Feindschaft. Der Beginn
wie das Ende des vorliegenden Tagebuchs dokumentiert diese Feindschaft auf
fatale Weise: Der gehasste Gegner ist nicht bloß ein literarischer Kontrahent,
er ist außerdem ein Jude, schlimmer – ein «Drecksjude» (russ. shid).
Prischwin bringt hier seinen militanten Antisemitismus unverhüllt, ja betont
aggressiv zur Geltung. Abgesehen davon, dass er den Juden pauschal vorwirft,
sie verhunzten durch ihre Sprechweise und ihren Jargon die erhabene großrussische
Sprache, kann er den populären Marschak «persönlich nicht einmal für einen
Schriftsteller» halten, und als großrussischer Nationalist unterstellt er ihm,
er schreibe nur deshalb russisch, weil er sein «ausländisches» (d.h.
russlandfeindliches, eben jüdisches) Denken kaschieren wolle – ein in Russland
weitverbreitetes antisemitisches und weltverschwörerisches Klischee, demzufolge
die Juden von ihrem althergebrachten Vorhaben ablenken wollten, «die jetzigen
Völker ins Wanken zu bringen und von ihren Fundamenten zu stürzen».
Am letzten Tag
dieses Horrorjahres, zu Silvester 1936, kommt Prischwin noch einmal auf
Marschak zurück in der Befürchtung, der einflussreiche Gegner könnte sich von
den ihm zugefügten «Schlägen» erholt haben. Folglich werde er den «Kampf» gegen
ihn im neuen Jahr wieder aufnehmen und dafür zusätzlich ein paar gleichgesinnte
«kluge Leute» rekrutieren; und ebenso offenherzig wie zynisch stellt er klar:
«Alles einzig mit dem Ziel, mir die Möglichkeit meines Schreibens in
Zurückgezogenheit finanziell abzusichern.» Denn: «Tatsächlich bekomme ich ja
nur dank meines Ruhms die Möglichkeit, mich mit dem zu befassen, womit ich mich
befassen will.»
•
Eben dies scheint
für Michail Prischwin Priorität zu haben – sich im bestehenden System eine
abgehobene Position zu verschaffen, die ihn jeder Kritik entziehen und ihm ein
selbstbestimmtes Dasein im repressiven Sowjetstaat ermöglichen sollte: «… man
will unaufhaltsam höher hinauf, und dort ist man dann von allem losgelöst.» Ein
naives, allzu hochfliegendes Begehren! Prischwins Kampf gegen Samuil Marschak –
wie auch seine Verachtung für andere jüdische Autoren – ist demnach nicht nur
von Rassenhass und Kollegenneid inspiriert, es ist auch ein Machtkampf um persönliche
Verfügungsgewalt im stalinistischen Literaturbetrieb. Doch lediglich
andeutungsweise befragt sich Prischwin hin und wieder selbstkritisch zur
Rechtmäßigkeit und Moral seines Verhaltens – ihm genügt der schlichte Vermerk:
«Bin mit Drehen und Wenden ungeschoren davongekommen.» Und er bleibt überzeugt
davon, dass ihn sein «Lebensgefühl» nicht täuscht, dass es vielmehr die einzig
«richtige Linie» ist.
Von tödlichem
«Kampf» berichtet Prischwin indes sehr oft und sehr ausführlich auch im
Zusammenhang mit seinen privaten Jagdausflügen, die als blutrünstige Episoden
auf befremdliche Weise mit der damaligen mörderischen Massenverfolgung
unliebsamer Staatsbürger korrespondieren. «All diese Jagden mit dem Hetzhund
gleichen in diesem Jahr einer Alkoholsucht, je müder man ist, desto heftiger
verlangt es einen danach.» Prischwin selbst vergleicht den Jagdinstinkt mit dem
Machtinstinkt der Sowjetführer und die Hetzjagd auf Wildtiere mit der
Verfolgung von Staatsfeinden durch abgerichtete Bluthunde: «Das hat etwas
Jägermäßiges», lässt er sich von einem führenden Parteifunktionär bestätigen.
Als
Naturliebhaber und speziell als Tierfreund hat er gleichwohl keinerlei Skrupel,
regelmäßig und mit eingestandenem Vergnügen auf Wild- oder Vogeljagd zu gehen,
und in detailgenauer Schilderung führt er ungeschönt vor Augen, wie
angeschossene Tiere – vom Wildschwein bis zum Auerhahn – von seinem Bluthund
gehetzt, erlegt und zerfleischt werden: «Wenn mein Hund Trubatsch einen Hasen
erreicht, seine jungen Zähne ins lebendige Fleisch schlägt und hastig (um
schneller als die Jäger zu sein) Stücke des warmen und blutigen Fleischs direkt
mit Haut und Fell verschlingt, so kann man ein Glück dieser Art auch bei
Menschen für möglich halten (es ist furchterregend und widerwärtig, und
zugleich fühlt man sich hingezogen, es auszuprobieren).»
Das liest sich
wie eine verkappte Erklärung (wenn auch keineswegs als implizite
Rechtfertigung) des Kannibalismus, der zur Zeit des stalinistischen
Hungerterrors in den frühen 1930er Jahren vielfach beobachtet wurde und von dem
der gut informierte Prischwin sicherlich gewusst hat.
•
Man hat Michail
Prischwins Tagebücher – in der Druckfassung insgesamt 18 Bände aus dem Zeitraum
von 1905 bis 1954 – gern als «intim», sogar als «geheim» beziehungsweise als
«verboten» bezeichnet, doch dies trifft bei weitem nicht für deren Gesamtheit
zu. Denn zahlreiche Eintragungen hat der Autor als Entwürfe oder Versatzstücke
für spätere Erzählwerke genutzt. Auch in der Stalinzeit konnte Prischwin
manches daraus problemlos veröffentlichen. Viele Notate sind in seine
autobiographischen Schriften, in seine belletristische oder essayistische Prosa
eingegangen.
Was an den
Tagebüchern (erschienen 1991 bis 2017) «geheim» oder «problema-tisch» gewesen
sein mag, sind weniger seine politischen und kulturkritischen Kommentare aus
den 1930er Jahren als vielmehr die bekenntnishaften Aufzeichnungen des
vorrevo-lutionären Jahrzehnts sowie aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis
zu Prischwins Tod. Hier gewinnt der Autor tatsächlich ein persönliches, dabei
keineswegs heroisches Profil als stets zweifelnder Gott- und Wahrheitssucher,
aber ebenso als ein Mensch und Künstler, der unentwegt schwankte zwischen
tiefer Zerknirschung, profunder Nachdenklichkeit und anmaßender
Selbstgewissheit.
Der stattliche, nun in deutscher
Erstübersetzung vorliegende Einzelband aus Prischwins Tagebüchern kann für das
Werk insgesamt naturgemäss nicht repräsentativ sein, bietet aber ein
bedeutsames Teilstück daraus. Das gewichtige Buch präsentiert sich in eindrücklicher,
wenn nicht einschüchternder Manier: 438 Druckseiten, die zur Hälfte auf den wissenschaftlich
hochgerüsteten «Anhang» entfallen, bestehend aus einem detaillierten Anmerkungsapparat,
editorischen Erläuterungen und einem separaten literarhistorischen Essay. Dazu
kommen mehrere Faksimiles aus den Handschriften des Autors, die allerdings
wegen mangelnder Reproqualität unleserlich bleiben und deshalb außer Betracht
fallen.
Die
textkritische Inszenierung des Werks mit den bisweilen allzu weitläufigen
Kommentaren mag zu dessen Verständnis manches beitragen, problematisiert jedoch
unnötig die unbefangene Lektüre, und bei aller bemühten Wissenschaftlichkeit
ist nicht zu übersehen, dass Prischwin hier einseitig als Opfer der
stalinistischen Repression und nicht auch als Helfershelfer und Nutzniesser des
Gewaltregimes dargestellt wird. Selbst sein kruder Antisemitismus findet bei
der Herausgeberin eine durchweg schonende Erklärung (durch Rückführung auf
Dostojewskij und Rosanow) statt der hier erforderlichen dezidierten Widerrede.
Michail
Prischwin, «Дневники / Tagebücher (1936)». Aus dem Russischen, herausgegeben und
kommentiert von Eveline Passet. Nachworte von Eveline Passet und Jutta
Scherrer. Guggolz Verlag, Berlin 2025. 437 Seiten. 34,00 Euro.


