Corinna Schubert: Masken denken – in Masken denken
Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen
Jan Kuhlbrodt
Corinna Schubert: Masken denken – in Masken denken. Figur und
Fiktion bei Friedrich Nietzsche. Bielefeld ([transcript] Verlag) 2020. 264
Seiten. 39,00 Euro.
Nietzsche und die Masken
Ann Cotten postete vor kurzem ein Gedicht von Christine Lavant:
Herr, lass mich um Masken beten!Herr, lass mich um Masken beten,dass die andern mich ertragen,dass die unentwegten Klagennicht aus meinen Augen treten.Masken, Masken gib mir viele!Jede kühner als die letzte,dass ich durch dies ausgesetzteLeben gehe wie durch Spiele.Selbst ein Spieler bis zum Letzten!Mit dem ärmsten, abgehetztenWort noch ein Gewolltes wagend;eine Geste, welche schlagend,Abwehr einhält, bis zum Rande …Masken gib mir und Gewande,welche alles übersteigen,Tiefes bergen, Flaches zeigen.Dass die andern mich ertrügen,gib mir Masken, gib mir Lügen!
Dem Impuls, sofort zum Regal zu springen und nach dem Lavantband
zu suchen, widerstand ich, weil hier ja genug Bücher vor mir liegen. Unter
anderem eines von Corinna Schubert: Masken denken – In Masken denken. Figur und
Fiktion bei Friedrich Nietzsche. Corinna Schubert arbeitet derzeit am
Nietzschearchiv in Weimar, also gewissermaßen an der Quelle. In ihrem Buch geht
sie dem Maskenmotiv im Werk Nietzsches nach, und entwirft damit gleichfalls so
etwas wie eine Architektur des Nietzscheschen Denkens. Wobei Architektur
vielleicht das falsche Wort ist, denn seine Begrifflichkeiten erweisen sich als
fluid.
„Sein am prominentesten in der Genealogie der Moral dargestellter 'Begriff des Begriffs' weist darüber nochmals hinaus: alle Begriffe, in denen sich ein ganzer Prozess semiotisch zusammenfasst, entziehen sich der Definition, definierbar ist nur das, was keine Geschichte hat.“
Das schreibt Schubert einleitend.
Entsprechend ist auch der Begriff der Maske in der Wandlung
begriffen. Und das, was in dem Gedicht Lavants anklingt, ist nur jener Aspekt,
dass die Maske zuweilen als Kleidungsstück über das eigentliche Gesicht gezogen
wird. Die Maske als Lüge.
(Gerade aber bekommt die Maske im Alltag als
Mund-Nasenschutz noch einmal eine ganz andere Bedeutung. Aber das nur am Rande.)
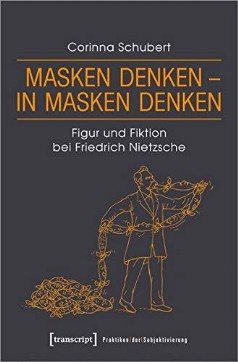
Schubert liest sich durch Nietzsches Werke, um das
Maskenmotiv zu ergründen, und sie endet letztlich bei der Frage nach dem
menschlichen „Ich“, das sich zuweilen hinter der Maske verbirgt oder eben durch
die Maske erst sichtbar zu werden scheint. Eine ganz andere Funktion hat die
Maske darüber hinaus in der Aufführungspraxis antiker Tragödien, und da
unterscheiden sich die Geister fundamental. Denn der Sinn der Maske verändert
sich je nach der Interpretation der Funktion des Chores entscheidend. Gibt er
allgemeine Reflexionen kund, vertritt er den Volkswillen, oder ist er
gewissermaßen eine verstärkte Darstellung der Seelenqual des handelnden Helden?
Je nachdem. Wie die Antwort ausfällt, verändert sich Gehalt und Funktion der
Maske.
Manchmal kommen mir die Vorgänge in der Welt und damit die
im Netz schon zwingend vor. Ich bin seit einiger Zeit mit Trautschs „Theorie
tragischer Erfahrung“ befasst; die implizit eine Nietzsche-Kritik enthält. Grob
könnte man sagen, dass Nietzsche in der Tragödie das andere der Philosophie
erkennt, das dionysische Dunkle, das sich einer rationalen Erfassung entzieht.
Philosophie und Tragödie sind gegenläufig.
„Gleichwohl gibt es am Ende der Tragödie nach Nietzsche ein
Übermaß des Dionysischen. Denn das Individuum als Manifestation des
Apollinischen geht in ihr zu Grunde. Damit die Tragödie dennoch die
zuschauenden Individuen zum Leben verführen kann, muss sie nach Nietzsche die
Dionysische Kunst sein, 'die uns von der ewigen Lust des Daseins überzeugen
will.'“ Schon der Name des ganzen Teils des Buches von Trautsch verrät eben
jene Nietzschekritik, die im Kapitel „Der Umschlag des Umschlags“ bei Trautsch detailreich
und argumentationssicher ausgeführt wird.
Aber immer, wenn ich eine plausible Nietzschekritik lese,
erwacht in mir eine Art Beschützerinstinkt, und ich suche einen Weg den
Philosophen zu retten. Dieser Weg ist, so scheint mir, in der Lektüre seiner
Texte selbst zu suchen, oder in der Lektüre von Arbeiten zu Nietzsche. Und eben
auch dieses Buches von Corinna Schubert, das im [transkript] Verlag in der
Reihe „Praktiken der Subjektivierung“ erschienen ist. Es ist neben Sarah
Kofmans „Nietzsche und die Metapher“ das spannendste, was ich in letzter Zeit
über den Philosophen mit dem Walrossbart gelesen habe.


