Christoph Menke: Kritik der Rechte // Theorie der Befreiung
Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen
Jan Kuhlbrodt
Christoph Menke: Kritik der Rechte. Berlin (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft) 2018. 486 Seiten. 20,00 Euro.
Christoph Menke: Theorie der Befreiung: Berlin (Suhrkamp Verlag) 2022. 720 Seiten. 36,00 Euro
Recht und Befreiung
Wenn es etwas gibt, das uns umgibt und nicht Natur ist, das uns also einschnürt, Wege verstellt, dann sind es Wirtschaft und Recht. Mehr noch als die Moral bestimmen sie unser Handeln und unseren Alltag.
Ein Buch, das vor einigen Jahren erschienen ist: Christoph Menke: Kritik der Rechte.
Ich dachte bei der Lektüre, das Ding würde reinhauen, wütende und hymnische Reaktionen auslösen, unternimmt es doch nichts weniger, als den gegenwärtigen Zustand bürgerlichen Rechts in einen historischen Kontext zu stellen und eben auf seine Historizität zu verweisen. Der gegenwärtige Rechtszustand ist Produkt eines geschichtlichen Prozesses, und als solches, weil die Geschichte keinen Abschluss kennt, ein vorübergehender und mithin zu überwindender.
In einer Rezension in der Süddeutschen Zeitung schrieb Christoph Möllers:
„In Menkes Rekonstruktion ist das subjektive Recht, der individuelle Anspruch, das entscheidende Element des bürgerlichen Rechts. Solche Rechte sind für ihn keine moralischen Universalien, sondern in einem politischen Kampf entstandene Formen. Durch sie kann eine Rechtsordnung ihre Gehalte in dem Subjekt reflektieren, das einen eigenen Anspruch erhebt.“
Aber das Recht ist auch eine Mühle, zwischen deren Mahlsteinen das Individuum durchaus auch zerrieben werden kann.
„Wir unpraktische Menschen aber nehmen für die arme politisch und sozial besitzlose Menge in Anspruch, was das gelehrte und gelehrige Bediententum der sogenannten Historiker als den wahren Stein der Weisen erfunden hat, um jede unlautere Anmaßung in lauteres Rechts-gold zu verwandeln. Wir vindizieren der Armut das Gewohnheitsrecht, und zwar ein Gewohnheitsrecht, welches nicht lokal ein Gewohnheitsrecht, sondern welches das Gewohnheitsrecht der Armut in allen Ländern ist. Wir gehen noch weiter und behaupten, dass das Gewohn-heitsrecht seiner Natur nach nur das Recht dieser untersten besitzlosen und elementarischen Masse sein kann.“
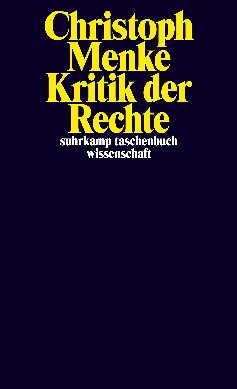
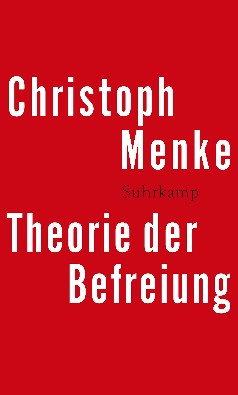
Das schreibt
nicht Menke, aber Karl Marx in einem Artikel von 1842 in der Neuen Rheinischen
Zeitung. (Debatten über das Holzdiebstahlgesetz). Aber Menke beruft sich im
Eingang seines beeindruckenden Buches auf die Marxsche Kritik.
Im Weiteren
liefert Menke eine systematische und historische Abhandlung, gewissermaßen als
Genese der gegenwärtigen Rechtssituation, die sich letztlich wieder als
paradoxe herausstellt.
Ich gebe zu, dass
ich mit Menkes Ausweg, dem Sklavenaufstand, noch nicht richtig klar kam. Er
situiert ihn jenseits der Vorstellungen des bürgerlichen Rechts und einer kommu-nistischen
Revolution.
„Das ist das Ziel des Sklavenaufstandes in seiner affirmativen Deutung. Sie versteht den aufständischen Sklaven so, dass er seine Schwäche bejaht, seine Passivität will. Dadurch entnaturalisiert der affirmative Sklavenaufstand die Existenz des Leidenden.“
Im letzten Jahr
erschien dann bei Suhrkamp Menkes „Theorie der Befreiung“, von dem ich
zumindest erwartete, es würde an die Kritik der Rechte anschließen und die
Vorstellung des Sklavenaufstandes präzisieren, gewissermaßen eine Theorie
entwickeln, die man weitestgehend als eine Art praktische Handlungsanweisung
verstehen könnte.
Aber hier saß ich
einem Denken auf, das mich mein Leben lang begleitet hatte und von der
eschatologischen Vorstellung genährt war, es könne (am Ende) der Geschichte
einen Zustand geben, in dem Recht und Gerechtigkeit in eins fallen könnten. Aber:
Die Befreiung
„kämpft immer einen doppelten Kampf: Sie kämpft gegen die Herrschaft und zugleich kämpft sie mit und gegen sich selbst“.
Das heißt,
Befreiungen bringen historisch immer ein befreites Subjekt hervor, zugleich
aber werden neuerlich Herrschaftsformen etabliert. Insofern richtet Menke
seinen Blick analysierend auf eine griechische Traditionslinie und auf eine
jüdische.
(Diese Gegenüberstellung
von Athen und Jerusalem finden wir übrigens auch bei Leo Schestow und Leo
Strauß. Letzter entwirft in „Naturrecht und Geschichte“ eine Theorie in der,
nach Korrespondenzen zu suchen, sich durchaus lohnt).
In der griechisch
verankerten Theorie entwickelt das Subjekt, das sich als geknechtetes begreift,
sowie seine Subjektivität im Zustand seiner Unterdrückung, eine Unterdrückung,
die es im Moment der Befreiung abstreift. Aus Sklaven werden damit Befreite
Sklaven.
Dem setzt Menke
die biblische Erzählung des brennenden Dornbuschs entgegen und etabliert einen
Begriff der Faszination: „Die Faszination ist die Erfahrung des Wirklichen;
darin befreit sie vom Gesetz der Identität, dass das gewohnheitsmäßige
Bestimmen beherrscht: Die Faszination ist die Erfahrung der Befreiung oder die
Befreiung in der Erfahrung.“
Letztere befreit
somit nicht das Subjekt, sondern aus der (geknechteten) Subjektivität in eine
radikale Offenheit. Menkes Studie ist so anregend herausfordernd, wie
lesenswert. Bleibt das wirtschaftliche Problem, dessen Lösung noch einmal
verschoben ist.
https://www.suhrkamp.de/buch/christoph-menke-theorie-der-befreiung-t-9783518587928


