Christine Langer: Ein Vogelruf trägt Fensterlicht (2)
Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen
Katharina Kohm
Christine Langer: Ein Vogelruf trägt Fensterlicht. Mit einem Nachwort von Mirko Bonné. Stuttgart (KrönerEditionKlöpfer) 2022. 160 Seiten. 20,00 Euro
"Ein Vogelruf trägt Fensterlicht". Die Dritte
Macht es Sinn, eine dritte Stimme zu bilden, nachdem es schon zwei aktuelle Rezensionen zu dem aktuellen Band „Ein Vogelruf trägt Fensterlicht“ von Christine Langer, erschienen bei KrönerEditionKlöpfer, gibt? Beide habe ich vorsätzlich nicht gelesen, weil ich sie dennoch schreibe, meinen eigenen Zugang und Pfad zu Langers Gedichten, der auch mit Orten von Begegnung zu tun haben wird.
Als Stipendiatin im Schriftstellerhaus Stuttgart begegneten mir ihre Gedichte in aller erster Linie auditiv. Ich besuchte an einem der heißesten Tage des sowieso sehr heißen Sommers im sowieso sehr heißen Stuttgarter Kessel im Juli ihre Lesung in der Stadtbibliothek.
Der sanfte und eindringliche Sonor der Stimme ließ die Gedichte in ihrer nötigen Langsamkeit greifbarer werden. Der Zusammenhang von Hören und Gedichten ist inhärent für die Wirkung, die auch beim nochmaligen Lesen nachwirkt, weil man die Stimme der Autorin mithört.
Langers Gedichte sind entschleunigende, ästhetische Gebilde, die bewusst in jedem Wort ausgewogen gesetzt sind wie Harmonien in Partituren, sodass nicht etwa ein Singsang, wohl aber eine Sprachmelodie entsteht, die zum Sujet der Texte, vor allem des Vegetativen passt.
Die Variation des Motivs des Vegetativen, des Spiels mit den Bildern und des Austauschprozesses zwischen Wahrnehmung und sprachkünstlerischer, klanglicher Gestaltung stehen im Mittelpunkt des Bandes. So wird in der Nachbemerkung von Mirko Bonné, bezogen auf den Titel des Bandes, eine sprachphilosophische Huhn-Ei-Frage gestellt:
„Kann ein Vogelruf etwas anderes tragen als sein Tönen, sein Lied? Wie trägt er ein Licht […] Oder ist es umgekehrt: Birgt in Wirklichkeit jeder Ruf eines Vogels ein Fenster, ein helles, aus Klängen, aus Klingendem?“
(Nachbemerkung, S. 97)
Das Gegenseitige Bedingen und die in der Schwebe sich befindenden Prozesse werden abgebildet, behutsam eingefan-gen und nicht entschieden aufgelöst.
Der Band besteht aus fünf Abschnitten, Teilbetrachtungen, Sequenzen oder, musikalisch ausgedrückt, Sätzen. Jedem der Teile wird ein kleiner Denkanstoß vorangestellt, eine grobe Richtung, eine Stimmung, eine Klangfarbe.
Wie kleine Meditationen verhalten sich die Gedichte, wie kleine Wunder von Details spiegeln sie sich im Großen Zusammenhang. Die Verschränkung von Kleinstem und Größtem, Nahem und Fernem wird unaufgeregt ineinander-geführt, wie es beispielsweise in einem der ersten Gedichte des Bandes „Tage wie dieser“ geschieht:
„Ins Blau fallende Sterne und alle Kerne faulender Früchte“ (S. 8)
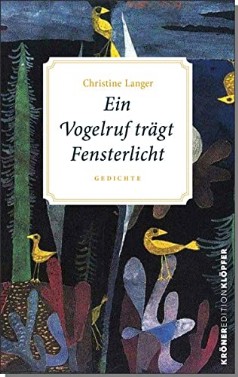
Schon bei diesem Vers sind die strukturierenden rhetorischen
Figuren mit der Aussage abgestimmt, bewusst gesetzt und bewahren sich eine
Leichtigkeit in der Ästhetik der Bilder, der Analogie von fallenden Sternen und
faulenden Früchten.
Das Motiv scheint dunkel-romantisch. Die Verse lassen sich
sogar an vielen Stellen auf diese Weise einzeln herausgreifen, weil sie jeweils
Spannung in einem Bild erzeugen, jedoch gleichzeitig diese durch die
harmonische und unaufgeregte Tonalität der Gedichte befrieden.
Beinahe impressionistisch und elegisch muss man an Rilke
denken, der mit einfachen Worten die Nägel an den Köpfen trifft und es dabei
immer schafft, genau solch einen impressionistischen meditativen Ton, der auch
melancholisch ist, beizubehalten.
So könnte das Gedicht „In Raps denken, einmal so“ in Bezug
zu Rilkes „Der Panther“ als sein Gegenteil gelesen werden, wenn auch in
ähnlichem Ton:
„Wie ihn der Himmel wiegt,Einer schleichenden Katze folgend.Für einen AugenblickLeih ich mir die Augen der Katze,Bin ich das RaschelnIm gelben Horizont, unsichtbar“ (S. 31)
Vögel, Bäume, Wolken, Himmel, Früchte, Vasen. Diese Motive
sammeln sich in einer Betrachtung, die sich im Bild wiederfindet, sich traut,
dort nicht auszubrechen, sondern zu verweilen.
Dennoch weisen die Gedichte über sich hinaus mit
Denkanstößen, die auch immer wieder poetologische Frage streifen, ohne die
Gedichte zu verkopfen, zu überfrachten. Sie verbleiben im Sensualistischen, wie
im Gedicht „Ins Gras schreiben“, anstatt ins Gras beißen:
„Ich wollte die Wolkenlieder einmal so gerne haltenUnd las sie auf im wehenden Gras, weshalb mirDie Schatten sehr nahe sind und beim Durch-Schreiten neue Schatten in die Schatten wachsen.Dies Schreiben, ein Fortleben vergangenenGrüns, wachsende Langsamkeit. AtemzugFür Atemzug zu Papier gebracht:Sehen durch luftiges Gras.“ (S. 21)
Das Gedicht erinnert an Hermann Hesses Gedicht „In Sand
geschrieben“, sein Gegenstück gerade im Bewahren-Wollen des Vergänglichen. Das
starke Bild, dass „Schatten in die Schatten wachsen“ zeugt von dem Mut, in
zeitlose und „althergebrachten“ Sujets von Gedichten, Neues zu finden und einzuweben.
Eine Auseinandersetzung mit Hölderlin ist im Gedicht
„Julitag, Tübingen“ schon angezeigt, aber auch mit Paul Celan, dessen berühmtes
Gedicht in Auseinandersetzung mit Hölderlin „Tübingen, Jänner“ lautet. Christine
Langer offerierte in dem Gespräch mit Carolin Callies, im Rahmen ihrer Lesung, ihren
engen Bezug zu Celans Lyrik. In dem sprachreflexiven und der Form nach sich an
Hölderlin anlehnenden Gedicht heißt es:
„Silben kreisen,Sie blieben,Sie bleiben,Sie wandern von außen nach innen,Sie halten die Erde, zeitverwurzelt.“ (S. 54)
Zu beachten ist bei allem die Sanftheit und Unaufgeregtheit
der Gedichte und auch eine gewisse Erotik der Bildsprache. Wie der zuerst
zitierte Vers der Verbindung zwischen Mikro- und Makrokosmischem in Engführung
von Stern und Frucht, so ist es hier der Mond im Schoß beim Liebesgedicht „Lied
zur Nacht“:
„Das Zimmer hier ist unser Wald – die Sonne sank –Bald steht der Mond in deinem Schoß – der Mond,Der nimmer geht – hörst du, wie er wehtIn den Kronen unsres Walds – ist es der Wind,Der niemals vorübergeht – der Mund in deinem SchoßBis in die Kronen unsres Walds – hörst du, wie es weht –Es ist das Dröhnen im Schoß, das nie vorübergeht“. (S. 47)
Die Korrespondenz von Mund und Mond, Wald und Zimmer wird
hier repetiert, variiert und verkörpert dabei genau jene Musikalität und
Klanglichkeit, die die Gedichte von Christine Langer auszeichnen und die
Konzentration und Entrückung bewirken, bei denen man nicht weiß, erzeugt das
Lied Welt, oder die Welt Lied.


