Björn Schäfer: Moscow River
Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen
Kristian Kühn
Der eingewebte Faden
Coleridge war nicht nur ein großer Dichter, sondern in späteren Jahren auch ein bedeutender Literaturkritiker. Er sagte vor ca. 200 Jahren u.a., für ihn sei Lyrik nur dann gelungen, wenn ihre Musikalität und Sinnhaftigkeit stimme. Letztlich ist diese duale Forderung Ausgangspunkt so mancher „seriöser“ Kulturzeitschrift heute noch, was Kritik betrifft, programmatisch etwa wie das Etikett „Sinn und Form“.
Einer der berühmt-berüchtigten Kritiker des 19. Jahrhunderts war diesbezüglich Charles-Augustin Sainte-Beuve. Trotz seiner Schärfe, die für heutige Verhältnisse unvorstellbar ist, strebten französische Lyriker vor etwa 150 Jahren mit allen Mitteln, Schmeicheleien, Bestechungsversuchen danach, von ihm in seiner wöchentlichen Kolumne (Neusprech:) „gegrillt“ zu werden. Er lobte, um zu massakrieren, und umgekehrt. So lässt er zum Beispiel Baudelaire in einem Artikel bis zuletzt unbeachtet, um dann auf ihn und die Gefahren der „literarischen Boheme“ hinzuweisen. Und er beschließt sein Urteil über die Fleurs du mal mit:
Kurz, M. Baudelaire ist es gelungen, sich am äußersten Ende einer für unbewohnbar geltenden Landzunge und jenseits der Grenzen der bekannten Romantik einen wunderlichen, reichverzierten, vielgequälten, doch auch koketten und geheimnisvollen Kiosk zu errichten, wo man Edgar Allan Poe liest, wo man auserlesene Sonette vorträgt, wo man sich mit Haschisch berauscht, um dann darüber zu diskutieren, wo man Opium und tausend abscheuliche Drogen aus Tassen von feinstem Porzellan nimmt. Diesen seltsamen Kiosk mit seinen Intarsien, der mit seiner höchst bewußten und buntgemischten Originalität seit einiger Zeit die Blicke auf die äußerste Spitze der romantischen Kamtschatka lenkt, nenne ich die folie Baudelaire. Der Verfasser ist zufrieden, etwas Unmögliches geleistet zu haben, dort, wohin, wie man glaubte, niemand gehen konnte.
Ein weiter Bogen hin zu diesem Buch, das seit geraumer Zeit auf meinem Schreibtisch liegt und „Moscow River“ heißt. Erschienen ist es bereits 2015, aber solange liegt es nicht bei mir. Es kam eines Tages 2017 angeflattert. Und eigentlich war ich sehr unentschlossen, nachdem ich es gelesen hatte, es auch zu „besprechen“. Es nennt sich eine Verserzählung, heraus-gegeben bei dem kleinen Berliner Verlag MaiNull3. Es ist die einzige Printedition dort und gibt sich auf den ersten Blick als ein queeres Buch, und ich dachte, naja, da verbrenn ich mir lieber nicht die Finger. Dann hab ich aber ein bisschen gegoogelt und auch die Webseite des Verlags mir angeschaut. Die Eigner sind der Autor dieser Verserzählung selber, Björn Schäfer, und der Kameramann Nils Linscheidt. Auf ihrer Webseite gibt es – neben diesem einen Buch – auch Animationen, „Poetry Clips“, Kurzfilme, Videoessays.
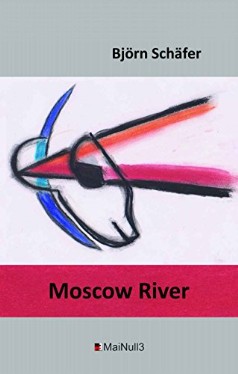
Irgendwie ist ein ernsthafter körperlicher Tantrismus spürbar in allem, was dort anzuklicken ist. Und deshalb scheint mir auch das Motto zu dieser lyrischen Reise mit diesem reißerischen Filmtitel, (das Motto ist aus Peter Handkes: Mein Jahr in der Niemandsbucht,) nicht mehr so aufschneiderisch wie anfangs vor dem Lesen: „Die Erde ist längst entdeckt. Aber immer noch werde ich dessen inne, was ich für mich Die Neue Welt nenne.“
Die Verserzählung beginnt, wie sollte es anders sein für ein queeres Buch, in Berlin, in Diskotheken, auf Dächern, etwa beim Gras Schnorren, bei Berlin als Metapher für ganz Europa, und bei diesem als Gleitgel und eben multikomplex, gleich in der Überschrift also bei Schäfer das ganze so umkämpfte Paket, und doch liegt seine erwünschte Freiheit unerreichbar in einer menschenvollen „Dunstigkeit“, nach eigenen Worten.
die Ampelschaltung zu kurzim belanglosen Schreitensagen wir mal träumerischwie eine Portion gedämpfte Tomaten
Schon zu Beginn ist die Sehnsucht nach dem Anderen, nach der Kamtschatka auch in Berlin gegenwärtig. Später heißt ein Kapitel „Die Steppe in mir“.
Ein Bild von einem Meister, das ihn in einem Dschingis-Khan-Outfit zeigt, taucht auf, (Tschik von 2012 lässt 2015 noch grüßen).
Da lockt eine ganz neue Weltich will einen Chip, einen Chip, einen Chip
Es ist zum Aus-der-Haut-Fahren, zumindest sich in Bewegung zu setzen, denn wer hat keine Angst vor dem Chip im Kopf dieser schönen neuen umfriedeten „Ich auch“-Welt, mit der uns Aldous Huxley als erster konfrontierte.
hast du Bock meinen Schwanz zu lutschenhm, verlockend, mein Freund steht da drübenwortlos gehe ich über die Teerpappe
Und die Reise über Riga nach Moskau beginnt. Mit etlichen Filmszenen. Mit oder ohne „Monsterpackung Präs[erv]ative“
asymetrisch, organisch fast
Und dann in Moskau die Textpassage, die mich nicht losließ, anfangs kopfschüttelnd, dann aber der Grund dafür, dass ich doch darüber schreibe:
Da bin ich ganz einfach hierokay, in Abstufungen, mit Gradendes Hintergangenseins, gnostischeNuancierungen, sozusagender Ablauf widerwärtiger Flüssigkeitenvon den Textilien erfolgt nicht.
Das ist zwar nicht formal, wohl aber dem Sinn nach Baudelaires gnostischer Traum („Wir nehmen also eine Kutsche. Ich hielt es für meine Pflicht, der Chefin eines großen Bordells eines meiner Bücher, das eben erschienen war, zu schenken. Als ich einen Blick auf mein Buch warf, das ich in der Hand hielt, stellte sich heraus, daß es ein obszönes Buch war, was mir die Notwendigkeit erklärte, das Werk dieser Frau zu schenken. Darüber hinaus aber war in meinem Geist diese Notwendigkeit eigentlich ein Vorwand, eine Gelegenheit, um im Vorbeigehen eines der Mädchen des Hauses zu vögeln, und daraus folgt, daß ich ohne die Notwendigkeit, das Buch zu überreichen, es nicht gewagt hätte, ein solches Haus aufzusuchen.“)
Bei Schäfer ist es die russische Sauna, die ihm den gnostischen Ekel vor der Vergänglichkeit einimpft:
mit starrem Blick, kaum verzogen, nur merklicham ausgekühlten Gesichtsausdrucklehnte Maxim ab, der Typ vor der Türgab uns darauf zwei Handtücherund nannte die Kosten, 5000 pro Schwanzdas heißt zweieinhalbtausend pro Ei
Soweit das Obszöne, und nun das Gnostische:
einer kommt auf uns zu, vielleicht Anfang dreißigund spritzt vor uns ab auf die Füßezum Glück, denke ich, liegen überall Küchentücher
Das Gnostische in uns hat nicht nur diesen Ekel vor der Verfinsterung, vor Verdinglichung
Achtung in den aufgespickten Grenzendurchlöchert, mit sich hineindrängendenFragen mischenhalt ego, der Typ ebenmeinetwegen auch gegendertzu abgestrahlten Maggi-Fix-Vorstellungenzu Hochtief-Wünschen
Sondern auch diesen Wunsch zu zerplatzen, zerrissen zu werden und als Ganzes neu aufzugehen, dieser dionysische Wahnsinn, immer nah am Tode,
ein Gefühl, eine Stimmungein breites Schwingendas ist Las Vegasdie Apokalypse der Zeichenein Vibrierenein Tanzen, Bewegenwechselndes Lichtund Schalldruck.
(Baudelaire geht in seinem Traum also durch den Puff, und bemerkt, dass ihm „der Schwanz zum aufgeknüpften Hosenschlitz heraushängt“ und dass seine nackten Füße in eine Pfütze geraten und nass sind. „Pah! – sage ich mir – ich werde sie mir vor dem Vögeln waschen und ehe ich das Haus wieder verlasse. – Ich gehe hinauf. – Von diesem Moment an spielt das Buch keine Rolle mehr.“ Auch er kommt an eine sinnlich wahrnehmbare Grenze, dann Schraffuren, ägyptische Figuren, schließlich an ein Monstrum auf einem Sockel, dieser Kronos, Gott der Gnostiker, der ist und immer bleibt, vor aller Zeit, mit der dicken Schlange um seine Glieder gewunden.)
Wieder in Berlin, ist die Steppe im Icherzähler eingezogen und aufgegangen. Der mit seinem Freund gedrehte Film (wilde Umarmungen „im Ganesha-Stil“) wird zerhackt und das lyrische Ich freut sich
doch im Grunde über den Faktdass er glücklicherweise keine Kettensägemitgebracht hatals ich zurückkehre, ist die Sachenahezu über die Bühne gegangentoll, sage ich, du Pannekökenn bettenund was soll ich jetztmit dem Film anfangenich blicke in seine Augendie mir für einen Momentden Anschein vermittelndass er die Kameraauch noch zerdeppern willaber das ist gleich wieder vorbeiwir setzen uns hintrinken, essen und reden
Dieser dionysische Sparagmos, dieses physische Zerrissen- und Verteiltwerden, (ein Vorläufer der Eucharistie, denn damit, mit den Fetzen und Ausflüssen, wurde schon damals zugleich Blut und Fleisch des Gottes gereicht,) wird bei Schäfer auch ein bisschen, sagen wir versuchsweise, als Form genutzt, daher seine teilweise verhackstückten Zeilen, als sei er Thomas Klings Prämisse einer „Sprachkörpersprache“ nachgefolgt:
„Die Schrift – Die Heilung.Das Zerreißen und das Wieder-Zusammensetzen der Einzelglieder – Das Schreiben.Das unausgesetzte, das naturgemäß vollständige Ausgesetztsein im Schreiben, mit der, und – haargenau – in der Schrift.“ (Projekt Vorzeitbelebung, Poetik)
Womit wir zurück beim Anfang wären, bei Coleridges Forderung nach einer adäquaten Musikalität. Denn um Spracharbeit im lyrischen Sinne handelt es sich bei Schäfer, trotz seiner teils eleganten Verwerfungen, nicht, dafür ist seine Sprache zu sehr im Fluss (im River) eines queeren aber gut vortragbaren Parlandos.
Fazit: Für Schäfer klingt die orgiastische Reise nach Moskau schließlich an der Ostsee aus, ein „geradezu sprachloses Meer“,
der schmale Lichtstrahl der rötlichen Sonne
das Dämonische, von dem ich hoffte
Abstand halten zu können
hat mich eingeholt
wie weit ich auch vor ihm fliehe
Björn Schäfer: Moscow River. Eine Verserzählung. Berlin (MaiNull3) 2015. 100 Seiten. 15,90 Euro.


