Bertram Reinecke: Bias und Unsicherheit - Teil 3
Memo/Essay > Aus dem Notizbuch > Essay
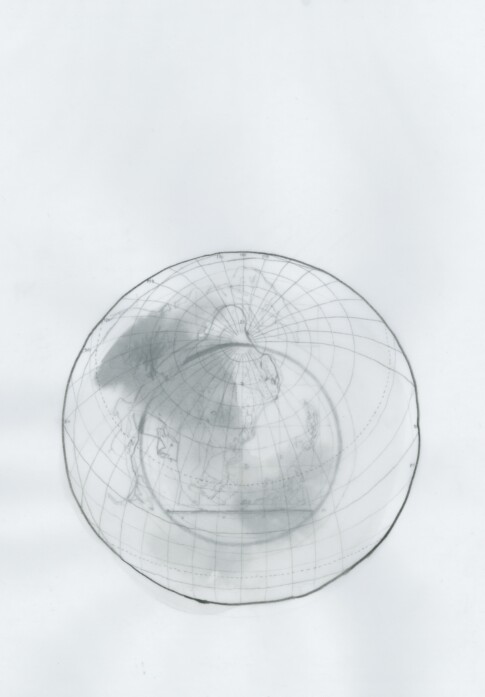
Bertram Reinecke
Bias und Unsicherheit - Einige Beobachtungen über die jüngere Sibylla Schwarz Rezeption
Teil 3
Fretowdichtung
Schon ihr allererstes datierbares Gedicht, die
„Fretowsche Fröhligkeit“, steigt zwar mit einem sehr geläufigen Topos, nämlich
dem Thema Wechsel der menschlichen Schicksale angesichts des Krieges ein, führt
diesen aber bereits souverän so plastisch und ökonomisch durch, dass es nicht
nur gewiss der Dichtung einer Zwölfjährigen, sondern jeder anderen (mindestens
Gelegenheits-)Dichtung alle Ehre gemacht hätte. Am ersten Bild bereits: „Jst
schon die gantze Welt im Bluhte durchgenetzet“ lässt sich wegen dessen Eingängigkeit
leicht übersehen, dass es sich um eine ungewöhnliche Fügung im Kontext der
barocken Dichtung handelt. Wo nicht ohnehin im ihrerzeit üblichen Gedicht eher Tränen netzen, oder „blutgenetzt“
einfach ein Synonym für „ist blutig“ darstellt (und sich meist auf Schwerter,
Speere oder Schlachtfelder bezieht), allenfalls Wasser etwas durchnetzt, fand
ich nur ein ähnliches, allerdings späteres, Beispiel bei Gryphius, wo das
faktische Durchweichen von Blut zumindest halbwegs so zum Bildspender für ein
Bild einer Zumutung wird, wie bei Schwarz: „Bald kommt er mir durchnetzt
von Blut vnd Threnen vor.“ (Cardenio und Celinde)
Die Frechheit, mit der sie die mythischen Gegenden der
Antike ganz handgreiflich nach Pommern zieht[1], fällt als
Besonderheit ins Auge, sie hantiert souverän und ideenreich mit heute mitunter
entlegen wirkenden klassischen Motiven und weiß schon in diesem frühen Alter
geschickte Beiworte zu setzen: „Der Kelber krummen sprunck“ und Situationen
durch ungewöhnliche Bildfügungen konkret zu machen: (über die Rinder des
Helios) „Als Jhn’n Ulisses Volck die besten ausgelesen / Und in den Bauch
verschart“ – sie haben sie nämlich aufgegessen bzw. dort sind sie nun
versteckt: Dort müsste er nun seine verschwundenen Rinder suchen.
Bereits hier
bearbeitet sie das Thema „die Kraft der Feder“ auf eine eigenständige Weise
hinter und neben dem Thema ländliche Idylle mit. Nach einem gängigen
Kontrasttopos (in der Stadt kommt alles von den natürlichen, guten Verhältnissen
ab etc.) folgen etymologische Überlegungen, die geschickt so motiviert sind,
als antworteten sie auf die Lügengerüchte der Städter:
...Der in der Stadt nur wohnt / da nichts als Krieg und Streit /Als böß gerüchte wechst und harte eisern zeit /Woher der Nahme sey / den dises Dorff bekommen ?Der wiße / daß er nicht aus Griechen ist genommen /Noch auß Arabien / den Fretow ist ein Wort /Das von der Einfalt Volck / den Bauwren / erst gehört /Den’n es zum ersten mahl ist in den Mund geflogen /Und etwan unbedacht dem Dorffe zugezogen /Dieweil der Ackersman auff seinen Pflug nur denckt /Und mit der Wörter zier sich leßet ungekrenckt /Weils sein Beruef nicht ist ; Der Nahme mag so bleiben /Wans aber nöttig thut / so kan man jhm zu schreibenViel Nahmen / die es werth / und mit der that erfüllt :Es heißt ein Ort / da man die Last der Sorgen stillt ; ¶Ein Wohnplatz aller Lust / von Pallas außerlesen ;Ein Kunststück der Nathur ; es heist ein herlich wesen /
Die Idylle wird
dabei als eine von der Dichterin gemachte vorgezeigt. Es handelt sich also
zugleich um Metadichtung. Nach einem (zugegeben vielleicht etwas länglichen)
weiteren Lobpreis erhält dieses Bild
einen weiteren Dreh, indem wiederum die Schönheit des Ortes in seiner Natürlichkeit die Leistung der Kunst selbst überbietet:
Zwar ist ein Werck / da die Natur hat anbeweisetEin guhtes Meisterstück / wol würdig / daß mans preiset /Und in die Bücher setzt / so ist mein Fretow doch /Da selbst die Einfalt wohnt / viel besser aber noch / ¶Als da man Trug und List bey schönen Künsten findet /Hier / hier ist Lieb und Trew / die nicht so leicht verschwindet /…“
Später im Text
setzt sie dann die Kunst wieder in ihr Recht: Sie weiß der Schönheit des Ortes
Schmuck und Ewigkeit zu verleihen: „… Als vieler Menschen fleiß / darümb man
Fretow findt / Jn vollen Bluhmen stehn / so lange Bücher sindt /“
Diese Haltung
wird im zweiten Fretowgedicht[2] zugespitzt, die
Dichterin eilt auf den Hilferuf der „Neun Göttinnen“ herbei und bietet ihre Feder an, damit diese Schwert und
Schild liegen-lassen können:
Apollo sey gegrüst mit deinen Pierinnen /Mit deiner Fröligkeit / mit deinen Neun Göttinnen /Sampt der bemühten Schar / die itzt zu felde liegt /Die Schildt und Waffen trägt / und mit dem Neide kriegt.Glück zu / du wehrte Schar ! Jch bin zu Lande kommenAuß einer rauhen See / und hab auch schon vernommen /Daß abermahl der Neid hatt mit euch angesetzt ;Jch komm ich komme schon / die Feder ist genetzt /Und spring euch Frölich bey. Last Helm und Schild nur liegen /Wir wollen mit der Krafft der klugen Feder kriegen
Ihre Feder ist
stärker als der Gott Apollo und seine Schar! Das ist ziemlich frech, nicht nur
für ein 12 Jahre altes Mädchen![3] Ich meine das
im Guten, denn uns kann zu unserem Vergnügen egal sein, ob die ZeitgenossInnen
ihre Texte goutierten. Es ist ja überliefert, dass sie sich harscher Kritik
ausgesetzt sah. Es ist unwichtig, ob nach deren Maßstäben hier Regeln der
zeitgenössischen Angemessenheit verletzt, anderswo vielleicht theologische
Feinheiten misslich gegriffen wurden. Wir dürfen das Ungehörige als das Unerhörte
schätzen. Immerhin räumt sie ein, dass sie aus Apollos Kinderstube kam: „Der
Neid doch ist ihm feindt / und hett eß[4] lengst gebracht
/ Jns Hauß der Sterbligkeit / wen keine Bücher wehren / Wen nicht Apollo uns die Feder halten lehren“.
Dennoch ist es
zuallererst nun ihre Verantwortung, Fretow zu bewahren: „So lang mein Auge
sieht / solang mein Fuß noch geht / So lang als noch mein Geist in seinem
Kerker steht / Soll Fretow auch noch seyn …“ erst dann folgen die Sonne, der
Mond, der große Wagen, die gewissermaßen dabei sekundieren, ihrem Arkadien
Ewigkeit zu versprechen. Der Neid wird zur Rede gestellt und ihm wird die Cui
bono Frage vorgelegt. Etwas grob vielleicht wird hier das ganze Welttheater in
Stellung gebracht, vor dessen Hintergrund natürlich alles und auch der Neid
vergeblich ist, aber dann wird der Neid zitiert:
Du sagst / und tichtest viel / es mangelt Holtz und Weide /Und wan du mehr nicht weist / so trägt es schlecht getreide /Baldt ist kein Reichthum da / baldt macht das Wasser kalt /Baldt mangelt dis baldt das / baldt ist kein grüner wald /Baldt liegt der Ort nicht guht / ...
Einerseits ist
diese Stelle von der frappanten Konkretion, wie wir sie auch an manchem Gedicht
etwa Dachs schätzen[5], andererseits
ist sie eine geschickte Ersetzungsfigur, die der Dichterin in der pars pro toto
Figur Vorwürfe zu ersparen scheint, die weit heikler zu widerlegen wären.[6]
Du trennest uns doch nicht / wan schon kein Holtz noch WeideBey uns vorhanden wehr / wan schon kein guht GetreideAuff unserm Acker wüchs / was gehet uns das an ?Das Dannholtz haben wir / das gnug erfrewen kan /Darauff der Helicon so zierlich ist gegründet /…Die Freundtschafft macht uns reich / wir kommen nicht zu dir / ¶Und bitten unser brodt / wir wollen das nicht haben /Was du für Reichthumb heltst / sind reicher von den gabenDer Freundtschafft / als du bist ...
Gegen den Neid,
an die Seite von Reichtum, Ehrsucht und Falschheit gerückt, wird anschließend
unter Wiederaufnahme des Vergänglichkeitsmotives das Gleichnis vom reichen
Kornbauern in Stellung gebracht. An sich ist das naheliegend und in ihrer Zeit
alles andere als ein innovativer Einfall, wäre hier nicht sozusagen in effigie
der eigentliche Verdacht, dass die Fretower Freisinnigkeit eine zu große war,
dadurch miterledigt, dass die Dichterin sich so in die Rolle der christlich
moralischen Autorität gerückt hätte. Im Fazit gelingt ihr eines dieser berückenden,
zugleich sinnlich konkreten und allegorischen Bilder, die für sie so typisch
sind:
Das Wasser / das da ist / ist nützlich auch zu nennen /Und wan auch das nicht wehr / so würd ich schwerlich kennenDen grünen Helicon. Auff diesem Wasser stehtDes bleichen Charons Schiff[7] / das in die Felder geht /Da keine Sterbligkeit / kein Leumden wird gefunden /[8]
Auch die sprichwörtliche
Hirtenmusik wird ganz praktisch spieltechnisch betrachtet:
Ein jeder Schäffer singt / ...… und kan viel besser greiffenAn disem Ort / als sonst / auf seiner guhten Pfeiffen.
Nachdem der Neid
gründlich zurechtgewiesen ist, wird er am Ende mit der Drohung aus der
Standpauke entlassen, ihre Feder würde ihn nicht wieder so lang ungeschoren
davonkommen lassen:
Und das nimb so verlieb / was ich dir itzt geschrieben /Biß das du uns wirst mehr mit Plauderey betrüben /So wil ich nicht so lang / wie itzundt ist geschehn /Ohn Feder und Papyr auff dein Verleümbden sehn.
Ich übergehe
hier die dritte (komplex konstruierte) Fretowdichtung [9], die die lose
Rede einer neidischen Unvernunft für den Zorn der Götter und den Zusammenbruch
der Fretower Idylle haftbar macht, und werfe einen Blick in das „Trawer=Spiel /
Wegen Einäscherung jhres Freudenorts Fretow“. In diesem Minidrama mit drei
Abschlusschören tritt die dichtende Instanz als Figur „Autor“ mit eigenen
Redeteilen ins Geschehen ein: Sie überbringt den Göttern die Nachricht von den
Wirkungen ihrer Beschlüsse, legt Zeugnis ab in der für sie typischen
gleichzeitig mythologischen und konkret sinnlichen Zeichnung:
…. / da leuft der gute Pan /Tregt seine Feld=Schalmey[10] / und groben Dulcian.Da komt Melpomene / mit ungeseumten Füssen /Rent wie ein durstig Hirsch / die andren Schwestern müßenNicht ferne von jhr sein / hört / wie sie weint und heült /Als ob jhr ander Volck sich etwa lang verweilt.
Diese Autoreninstanz blickt und kommentiert also nicht
extradiegetisch wie im Faunus, sondern ist eine Figur innerhalb des erzählten
Geschehens, und zwar auf Augenhöhe mit den Göttern. Sie beschwichtigt etwa
Mercurius, der im Schrecken der „Schwäger“ eine Beleidigung erblicken will[11]: „Verzeih ihn’n
grosser Gott ; sie können sich nicht schicken / Jn die so schnelle Post / die
Geister sind verwirrt“ und steht damit noch über den Musen, die das Wirken der
Götter erleiden müssen.[12]
Die Stimme der Musen gibt der letzte der drei Trauerchöre
wieder. Die Musen erleiden passiv - im Gegensatz zur aktiv eingreifenden
Schriftstellerin. Ohne eigene Eingebung werden
sie als Objekte der göttlichen Beschlüsse von der panischen Menge
mitgerissen:
Nur fort so schlecht zum Tohr auslaufen /Und ob zwar bleiben besser steht /So rieff man doch : jhr Mägde geht.Was wolten wir da weiter sagen ?Wir wurden in die Flucht geschlagen /Weil Phöbus selbst nicht war zu haus /So trieb man seine Töchter aus.Wir liefen fort / halb angezogenEuterpen ist jhr Kleid entflogen /Thalia ließ die Schürtze gehn /Melpomene blieb barfuß stehn.Den Harbandt lies Erato hindenWir konten all uns selbst kaum finden /Uns ist benetzet Rock und Saum /Und kamen durch das Wasser kaum. ¶Uns ward nicht so viel Zeit gelassen /Daß wir die Lauten könten fassen /
…Wir liessen Laut=und Geigen liegen /Und konten keinen Krantz mit kriegen /Man warff das grüne Lorbeer=LaubErbärmlich in der Erden Staub.
Dies nun
zerstörte Arkadien wiederum bevölkern keine Flöte spielenden idealischen
Hirten, sondern Bauern, die Kohl oder Käse essen, Dünnbier trinken und am
Nutznieß ihrer Arbeit und am wirtschaftlichen Gewinn ihrer Unternehmungen
konkret interessiert sind:
Was wir haben ausgestreut /Wird von andern abgemeytUnsre Kelber sprungen woll ;Unsre Scheunen wahren voll ;Unsre Fercklein nahmen zu ;Mager war nicht eine Kuh ;Unsre hüner legten sehr ;
Der dritte Chor, der Chor der Schwäger, scheint den
Landlebensgefährten aus Bekannt- und Verwandtschaft der Dichterin in den Mund
gelegt. Er beginnt mit einer Folge von Flehrufen an die Götter, die in der
Folge mit einem Katalog von Fragen dringlich gemacht werden, die die Zerstörung
des Ortes aufwirft. Diese sind teils konventionell, teils aber irritierend
schillernd: „Wer wird die Sterbe=Kunst den lebendigen lehren?“ „Wer wird
hinfort den Storch / in voller grösse sehn /“ „Wo wird der eine nun hinfort den
dritten jagen?“ Einige lassen sich aus dem Text heraus auflösen, so findet das
zweite Beispiel eine Art Antwort in: „Der Augen nützer Schein ist fast bey uns
verlohren /“, andere bleiben in ihrer Sperrigkeit stehen. Die Lektüre bleibt anregend, selbst, wo hier
und da dieses schillernde Geheimnis einfach bloß anzeigen sollte, dass eine
ZeitgenossInnen selbstverständliche Anspielung nicht verstanden wurde oder eine
unentschlüssel-bar persönliche Anmerkung der Autorin beigemischt wäre.
Unzulängliche Pastoraldichtung?
Wohlgemerkt,
wir loben hier gerade vornehmlich solche Stellen, die der Dichterin folgendes
Monendum von Barbara Becker-Cantarino[13] einbrachten: „Solche Verse zeigen, wie unzu-länglich die
Mythologie und Pastoraldichtung war, um darin zeitgenössische Anliegen zu
fassen. Diese Konvention versagte“. (Das Diktum lässt sich natürlich in dieser
Form mühelos auch auf die Nymphen Paul Flemings oder Stellen bei Opitz übertragen.)
Diese lapidare Bemerkung scheint pars pro toto für die ganze Verfremdung
mittels mythologischer Motive gedacht, denn ihre positive Beurteilung des
Wertes der Schwarzschen Dichtung stützt Becker-Cantarino ausschließ-lich auf ein
paar herausgepickte realistisch anmutende Stellen. Eine solche Lesart übersieht,
dass gerade die pagane Schäferdichtung schon bei Vergil, Longus oder Theokrit
ein urbanes Phänomen war und nie abbildend, sondern stets projizierend gedacht
wurde.
Man muss
andersherum fragen: Welche Möglichkeit hat Schwarz diesen in antike Bildung
eingekleideten Sageweisen hinzugefügt, auch weil sich dieses Muster vielleicht
gegen ihre Anliegen sperrte. Auch wenn man zugibt, dass manch forsche barocke
Projektion von Wirk-lichkeit auf vorgegebene antike Stoffe uns heute allzu
abstrakt erscheinen mag, ließe sich solcher Kritik einiges entgegen halten: Die
Misere des 30-jährigen Krieges wird in vieler Hinsicht handgreiflich gewesen
sein, sie in Kunst abzubilden könnte entbehrlich gewesen sein. In gleichem Maße,
wie wir die Abbildung historischer Wirklichkeiten in älteren Gedichten
goutieren, lehnen wir dieses Ansinnen für die Gegenwart fast stets ab: Wenn
eineR die Grauen z.B. des Ukrainekrieges abschilderte, würden wir uns zunächst
fragen, zu welchem übergeordneten Zweck denn dies geschähe und erst, wenn diese
Einbindung in einen größeren Horizont uns überzeugte, ästhetische Qualität
beurteilen. Wir würden andernfalls einem solchen Gedicht günstigstenfalls
Leitartikelei in Gedichtform, wenn nicht moralische Erpressung mit dem
bedeutenden Gegenstand vorwerfen. Erst in dem Moment, in dem uns die
Weiterverarbeitung zu etwas drittem, einem genuin ästhetischen Gegenstand
gelungen schiene, pflegten wir den Ehrentitel „Kunst“ für eine Abschilderung
der Wirklichkeit zu vergeben.[14]
Durch die
gehaltene Spannung zwischen entlegenen Bereichen entsteht bei Sibylla Schwarz
oft eine Art neue Sichtbarkeit durch Verfremdung, etwa wenn sie leichthin
feststellt: „MArs kam neulich zu uns gehen“: Er kommt nämlich zu Fuß wie die Söldnerheere
des 30-jährigen Kriegs und beiläufig, wie die scheinbar ohne Sinn wechselnd
ein- und ausrückenden Abteilungen der verschiedenen Kriegsparteien in
Greifswald … und er beklagt sich bei der Dichterin, dass ihm beinahe die Helden
ausgegangen sind und er nicht recht weiß, wie es weitergehen soll.[15]
Man muss überdies
die allegorische Figur bei Schwarz hier gar nicht ausspielen gegen die konkrete
Beschreibung dort: „Ein jeder leufft davon / muß Hauß undt Hoff verlassen /
Kompt an den Bettelstab und geht auff frembder Gassen / Es werden ohne schew
die Alten abgethan / Das Kindt muß an den Spieß[16] / die Jungfrau bej den Man /[17]“, oder in einem Geburtstagsgedicht (!), wo es heißt:
„ … in disem großen ganzenJst nicht[s] alß kläglich tuhn / alß Kuglen / Stücken[18] / Schanzen /alß blutiger begin / alß Lanzen / Spieß und Schwerdt /alß Dieb=und Mörderey / alß leerer Tisch und Herdt. /Der Mensch muß viel beschwer / viel Widerwillen leiden /eh seine Seele kan des Leibes Kerker meiden ; /der sieht sein Vaterland ganz öd und wüste stehn /und jener siht sein Hauß von fern im Feur aufgehn.“[19]
Die
Ursache für Becker-Cantarinos Missbehagen dürfte woanders liegen: Die
entlegenen barocken Mittel der Verfremdung wirken sehr verspielt angesichts
eines so dramatischen Themas. Es erinnert daher eher an die allfällige Frage,
ob man angesichts von Leid, Elend, Umwelt-zerstörung denn noch guten Gewissens x
betreiben dürfe, zum Beispiel Gedichte schreiben.[20] Bei einem weniger dringlich furchtbaren Gegenstand kann
das Verfahren nämlich ungestörter seine Leuchtkraft entfalten. Etwa[21] in der „Nacht=Klage / über den überverhofften betroffenen
Abscheid ihrer lieben Freunde.“ in der die Dichterin „nur“ den plötzlichen
Abschied der besten FreundInnen beklagt:
Auff den Gassen ist Geschrey :Cloris sizt schon auff dem Wagen /Galathee lest mir sagen /daß sie schon von hinnen sey. ¶Hie läufft der / und hohlt den Paß /Jener geht das Schiff zu frachten /Seumsahl wil man ganz verachten /hie hilfft keiner Augen naß.
Uhrwerke
Natürlich mag es verführerisch sein, diese (nennen wir es)
Hemdsärmlichkeit und konkrete Direktheit aus ihrer Biografie zu erklären. Man hüte
sich aber zumindest davor, diesen Konnex zu eng zu ziehen, denn dann würde man
sich falsche Versprechen machen in Bezug auf andere weibliche (oder wahlweise
jugendliche) Schreibansätze im Barock. Man übersähe auch das raffiniert gebaute
Uhrwerk ihrer Texte. Wer etwa „Auff Jungfer Judith Tanckin Namenstagk“[22] läse, müsste ja
ansonsten annehmen, die Dichterin habe aus Verlegenheit um neue Einfälle einfach eine Phrase aus dem weiter oben erwähnten
Alexandrinereingang der Nachtklage wiederverwendet. Heißt es in der Nachtklage:
DAs große Liecht der Welt entzeücht sich nun der Erden /und eylet fort ins Meer / mit seinen müden Pferden ; ¶man hängt die Fenster zu / weil Morpheus komt heran /eß sehnt sich nach dem Schlaff / was Odem blasen kan ;Man sieht der Sternen Heer mit ihrem Golde prangen ;Auch Luna zeiget uns das Silber ihrer Wangendie Schaffe gehn zu Stall / der Schäffer geht zur Ruh ;eß regt sich niemand mehr / die Blumen tuhn sich zu ;Die Welt ist schon zu Bett / umringt mit vielen Träumen /Jch aber nur allein / ich geh hier bey den Bäumen /da weit und breit herum / der Tau / das Kind der Nacht /sampt meiner Zehren=qvell die Gräser feüchter macht.
So erhält in einem anderen Text der ganze Gedankenkomplex
um Bäume, Nacht, Träume, Einsamkeit, Traurigkeit, Krieg einen überraschenden
neuen Dreh. Der Motivkomplex wird verbunden mit den bei Namens- und
Geburtstagsbindebriefen aus ihrer Sicht besonders angemessenen hier aber weniger
nahe liegenden Sonnenmotiven:
AVrora kam herfür / das grosse Radt der Sonnen /Die Fackel aller Welt / hett Augen schon gewonnen /Und kam gleich auß der Seh : Diana gingk zur Ruh /Der Sternen schöne Schar schloß ihre Strahlen zu :Als ich / zu meiner Lust / im Garten ging spatzieren /Da gahr kein Federvieh war weit undt breit zu spüren /Da schon der rauhe Herbst die Blumen abgemeyt /Den Feldern gantz entfürt jhr buntes Sommerkleit. ¶Ey (sprach ich) lieber Gott ! wie alles sich vernewet ?Wie dieser sitzt und weint / undt jener sich erfrewet ?Wie alles Wechsel helt ? Nun kompt der Schne herfür /Und kurtz für diser Zeit war noch des Sommers Zier.Vor wenig Stunden noch lag ich in vollem Treumen /Umbringt mit schwartzer Nacht / nun geh ich bey den Beumen /Die mit den Esten sich verschürtzen über ein /An stat der Arme Bandt / und so gebunden sein.
Kein Wasser hat sich nun in langer Zeit ergossen /Der Frost hat Erd und Mär / wie gleichsahm / gantz verschloßen /Undt hellt die Wellen an / er bindt das gantze Landt /Er heist die Schiffe stehn / und ist ein harter Bandt.In summa / was du siehst in diesem grossen Runden /Ja selbst das grosse Rundt / ist durch und durch gebunden /O Mars / durch deinen Bandt / du ungebetner GastHast unser armes Landt ietzt grausahm umbgefast.Wer hilft uns doch von dir? Ist dann kein Raht zu finden?Vor hat ein Weibesbildt die Waffen künnen binden /O Freundin thu du auch / was Judith vor gethan /Nimb / nechst dem Nahmen / auch der Judith Thaten an!O Judith / Judith / komb / und hilf uns ietzt auß Nöten /Weil Holofernes Här uns gäntzlich fast will tötten!
Wollte man hier das Denken in Gedankenkomplexen und
Konzeptualisierungen nicht zur Kennt-nis nehmen, würde man das folgende
Marsmotiv vielleicht noch als erforderlich für den Einfall ansehen, die
angesprochene Judith mit der biblischen Gestalt zu identifizieren[23],
mag das Bindemotiv, das den Gott herbeiassoziiert aber für
etwas arbiträr halten usw.
Natürlich aber findet das Marsmotiv seine Vorbereitung aus
dem Natureingang, der zumindest das Thema Tod schon anzeigt, aus dem gleichen
Motivspeicher Natur wird das Bindemotiv entwickelt. Und auch das Motiv der
biblischen Judith wird nicht ad hoc nur wegen der Namensgleichheit zur Freundin
an den Mars gedockt, sondern ausgerechnet die erotische Kompo-nente ist bereits
vorher angelegt. (Schwarz hat natürlich gewusst, dass die biblische Judith als
Prostituierte galt.)
Wobei das biblische Judith-Motiv auf ein vielleicht 13-jähriges
Mädchen zu beziehen in sich schon außergewöhnlich ist. Man vergleicht
Jungfrauen ohne greifbare Lebensleistung in jener Zeit eher allgemein mit
Naturphänomenen oder mythologischen Figuren, die diese ewige Natur bewohnen,
etwa Nymphen etc., und nicht mit als der Historie angehörend gedachten
Gestalten von solcher Übergröße.[24]
Dem Leser, der, wie geschildert, ihre konkrete Direktheit
ihrer Jugend zuschriebe und dadurch die
Gedanklichkeit ihrer Literatur abblendete, kommt der Bezug des Kriegsmotivs auf
die Freundin wohlmöglich auch wiederum nicht sehr zwingend vor. Durch das
Fretow-Motiv ist der Krieg aber mit dem Komplex „Kampf wider den Neid“, also
gegen die Verleumdung verkoppelt und motiviert. Das Ganze ergibt einen klaren
Appell an die junge Frau, den diese, als Freundin, Leserin und Protagonistin
vieler ihrer Texte auch ohne weiteres verstanden haben dürfte.
Bekräftigt wird dieser Zusammenhang
dadurch, dass er in einem weiteren Gedicht aufscheint:
„Magddichte über den Abscheid meiner liebsten Freundinnen J. T. auß Greiffswaldt“.
Natürlich wird auf solche Konsistenz der Textes eher
aufmerksam, wer darauf rechnet, dass die Dichterin nicht ganz alles direkt
sagen möchte, was sie zu sagen hat, wer also bereits davon ausgeht, dass der
Text ein Tabu umschifft, wie es z.B. das der Dichterin zugeschriebene
homoerotische Begehren Judith Tanck gegenüber darstellt. Paola Bozzi hatte in
Bezug auf den Faunus hier von Heroglossie gesprochen. Ursula Kocher hatte eine
Diskursmischung diagnostiziert.
Insofern aber eine solche Annahme vielerorts als spekulativ
zurückgewiesen wurde: Wer diese Idee nicht mindestens in Erwägung zu ziehen
bereit ist, verstrickt sich möglicherweise in eine weit dramatischere
Spekulation. Offen homoerotische Texte, die mehr sein wollen als eine gezielte
Provokation oder Pornografie, wird man in einer Zeit, wo dies Begehren hart
sanktioniert wurde, in den seltensten Fällen finden. (Erst hundert Jahre nach
Geburt der Dichterin wird mit Catharina Margaretha Linck in Deutschland die
letzte Frau wegen ihres homoerotischen Begehrens als Sodomitin hingerichtet.)
Wir haben kaum literarische Textcorpora der Zeit, die mehr Indizien dafür
bereit halten, ihnen könne ein homoerotischer Subtext unterliegen als ihre
Werke.[25] Wer auf der
Suche nach der Geschichte der Homosexualität selbst an diesen besten
KandidatInnen vorbeigeht[26], muss implizit
unterstellen, das Phänomen habe gar keine Historie. Man näherte sich der
Geschichtsschreibung russischen oder neurechten Stils, die in der Homosexualität
ein junges Phänomen (westlicher Dekadenz) sehen möchte.
Vielleicht ließen sich solche spekulativen SkeptikerInnnen
zumindest davon überzeugen, dass der gewählte Interpretationsansatz über
untergründige Motivzusammenhänge zumindest nicht gänzlich in die Irre geht
(oder gar lediglich eine Hilfsannahme zugunsten der bevorzugten Deutung
darstellt), wenn er sich an einem ähnlichen Text als erfolgreich erweist, in
den die Frage des Begehrens nicht direkt involviert ist?
Ein weiteres Mal
findet sich der Komplex um Bäume, Nacht, Träume, Einsamkeit, Traurigkeit und Krieg in einem Anbindbrief, (dessen
Kriegsbeschreibung oben schon aus Anlass des Becker-Cantarinoschen Einwurfs
zitiert wurde). Auch hier ist die Nacht in den frühen Morgen verlegt. Das
Einsamkeitsmotiv tritt gewandelt auf, der Dichterin wird der Zugang zum Parnass
und zu den Pierinnen verwehrt und „Jnmittelst müßen wihr / wie eß sich wil gebühren
/ die zeit / die liebe Zeit / mit unsrer Leyer zieren /“ . Konsequenter Weise
bedichtet Schwarz zuerst ganz weltlich die Einwände, die „Momus“ (der
Kritikaster) gegen die Praxis des Bindens erhebt:
eß sey ein Kinderspiel / und könn ihm nicht behagen /eß sey nuhr Gauckel=werk / eß sey ein bloßer Tant /eß sey ein unnüz Ding / der Weißheit unbekant /eß sey der Ehrbarkeit zu wieder und der Tugend /gebühre nur allein der ungezähmten Jugend /und sey zur Wollust erst in guter Zeit erdacht /iezt aber durch den Krieg fast gänzlich abgebracht.
Die Dichterin
tritt diesen Vorwürfen nicht entgegen, sondern geht lediglich an ihnen vorüber,
als fehlte der Leyer die Kraft, wenn der Parnass verschlossen ist:
Wir wollen andere diß weidlich lassen streiten /und bleiben bloß dabei / eß sey zu allen zeiten /von vielen Jahren her / ein löblicher Gebrauch /demselben wollen wihr nun iezund folgen auch.
Auch hier steht
Band- (es lässt sich kein geeignetes
finden) und Kriegsmotiv in engem Zusammenhang. „Wo sucht man einen Band ? in
disem großen ganzen / Jst nicht[s] alß
kläglich tuhn / alß Kuglen / Stücken / Schanzen / [weiter: siehe oben]“ Dieses
Kriegsmotiv schickt sich zur Feierlaune natürlich eigentlich wenig. Interessant
ist, dass diese Liste des Kriegsungemachs, anders als bei den bekannten
Beispielen von Gryphius und Co., wo das nächste gern das vorige noch überbieten
zu wollen scheint, Züge einer Antiklimax trägt. Die geschilderten Leiden sind
immer weniger eng mit Krieg verbunden und scheinen immer alltäglich
subjektiver, sind teils noch nicht einmal eingetreten, sondern werden lediglich
erst erwartet, als wollte die Dichterin insgeheim bezweifeln, dass alles wieder
gut wäre, wenn nur der (als von außen hereinbrechend gedachte) Krieg erst vorüber
wäre. Dagegen wird die Vorstellung einer Idylle lediglich ex negativo
aufgerufen. (Denken sie jetzt nicht an rosa Elefanten.) Wobei der Übergang vom
Kriegspanorama in die negative Idylle fließend geschieht:
dem achten wird die Zeit bey seinen Gästen lang.Der Neundte fühlt Gefahr und Schaden an der Seelen /der zehnde muß sich stets mit schwerer Arbeit quälen.Den Jungen plagt der Hust / der Alte fühlt die Gicht /und klagt wie sehr eß ihn in seiner Seiten sticht.Der eylffte komt und klagt / wie sehr er ist geschlagen /den zwölfften wil man ganz auß seiner Hütten jagenJn Summa alles das / was Unheil heissen kan /trifft unser armes Land / und greifft uns sämbtlich an.Zu dem hat auch der Frost den Feldern abgenommenJhr grünes Sommerkleid / der Winter ist gekommen /der alles trübe macht / der Strauch steht abgelaubt /die Blumen sein ganz nackt / und aller Zier beraubt.Der Monde machet iezt viel Stunden zu den Träumen /der Stok steht ohne Wein / das Obst ist von den Bäumen ;
Pomona hat iezund im Garten keine Zier /und Flora zieht nicht mehr der Blumen Pracht herfür ;den Schäffer hört man nicht von seiner Fillis singen /die kleine Nachtigal lest nicht die Stim erklingen ;die Satyrn lauffen wegk / der Geisenhüter / Pan /legt gänzlich an die seit den groben Dulcian.[27]Die Frewde selber schläfft / was wollen wir dan gehen /und uns nach Fröligkeit im Elend ümme sehen ?
Den Einsatzpunkt in diese Idylle ex negativo markiert ein
fast wortgleich entnommenes Zeilenpaar aus Opitzens „Schäfferey von der Nimfen
Hercinie“, das hier wohl kaum gerade deswegen ausgewählt ist, weil die
Dichterin um ein eigenes Bild verlegen gewesen ist. Bei Opitz heißt es:
„Daselbst befandt ich mich, nach dem ich die Zeit zu vertreiben und meinen Gedancken desto freyer nach zu hengen, vor zweyen Tagen von einem andern Orte, welcher eben mit diesem Gebirge gräntzet unnd deß außgestandenen Uebels wegen bey itzo schwebenden jämmerlichen Kriegen nicht unbekandt ist, entwiechen war.Der Monde machte gleich mehr Stunden zu den Träumen, /Der Stock stundt ohne Wein, das Obst war von den Bäumen,Der strenge Nortwindt nam den Püschen ihre ZierUnd auff die Wage tratt der Scorpion herfür.“
Festgehalten sei: Erstens: Auch wenn dieser Text zu einem
anderen Ehrentag andere Dinge sagen möchte als der vorher besprochene, lässt
sich die am vorigen Text diagnostizierte Motivverschränkung auch in diesem Text
wiedererkennen. Zweitens ist auch hier sichtbar, dass die Dichterin auf eine
Leserschaft rechnete, die auch subtilere Winke zu dechiffrieren vermochte.
Wer der Dichtung ihr Reich bestreitet, zwingt sie dazu,
nichts weiter als die Misere der Verhältnisse abzuschildern. Statt sich der
Einstimmung auf die Feierlichkeit zu widmen, hat die Dichterin im bisherigen
Text genau solche Abschilderung und nicht mehr geboten. Die Reihe dieser Überlegungen
wird mit einer lapidaren Feststellung geschlossen: „Die Frewde selber schläfft
/ was wollen wir dan gehen / und uns nach Fröligkeit im Elend ümme sehen?“
Genau diesem Ansinnen verweigert sich das Gedicht ostentativ. (Es folgen
lediglich noch der Hinweis, dass das Band wenigstens von Herzen käme und ein
paar gute Wünsche.) Hier beginnt sich der Kreis zu schließen: Schon im
Trauerspiel um die Einäscherung Fretows hatte Pan als letztes Wort den zerstörerischen
Göttern zugerufen: „Jhr mögt euch / wenn jhr uns wolt so tyrannisch straffen /
Auch einen andren Pan und Geisen=Hüter schaffen.“[28]
Von hier aus gewinnen auch Ursula Kochers Überlegungen zur
Episteme der Figuren Faunus und Daphne innerhalb oder außerhalb des
allegorischen Weltbildes ihre Brisanz. Auch der Hinweis Hildebrandts zur Rückung
der Heinsius-Vorrede weg von einer objektivistischen Weltschau hin zu einer
konkreten Stellungnahme zu Zeitfragen zielt in diese Richtung. Die antiken
Mythen und Konzeptualisierungen sind für Schwarz bei weitem mehr als ein
Bildspeicher zur Bebilderung ihrer Texte im Sinne des Horazschen „Aut prodesse volunt aut
delectare poetae aut simul et iucunda et idonea dicere vitae“, sondern
konkreter Schauplatz in der Auseinandersetzung um Einstellungen und
Handlungsweisen. Insofern wir durch die philosophischen Bewegungen des
ausgehenden 20. Jahrhunderts zur Kenntnis nahmen, dass unsere Welt durch die
Sprache nicht lediglich beschrieben, sondern wesentlich sprachlich konstituiert
wird, kann diese engagierte Entäußerung der Dichterin in eine fremdartige
Bildwelt überraschend berühren, wenn wir sorgfältig zu lesen bereit sind.
Es zeigt
sich also, dass wir in Sibylla Schwarz einer Dichterpersönlichkeit begegnen,
die nicht nur punktuell die Dichtungskonventionen ihrer Zeit überschritt,
sondern einen originären Zugriff auf die Welt artikulierte, der allenfalls
durch die Verwendung des zeittypischen Motivrepertoires aus der Ferne mit
durchschnittlicheren Barocktexten verwechselbar werden mag. Wer seine Lektüre
von dem Misstrauen steuern lässt, in der Aufmerksamkeit für die Dichterin
spiegele sich vor allem unser gewachsenes Interesse an emanzipatorischen
Leistungen in der Geschichte, übersieht ihre originäre Stimme leicht.
Insbesondere bedarf sie auch nicht des Zugeständnisses, sie wäre zumindest
wegen ihrer Jugend etwas ganz besonderes, zumal solche Zugeständnisse in der
Regel die verteufelte Neigung haben, im nächsten Atemzug wieder entzogen zu
werden. Wir können sie lesen und studieren (oder es lassen), wie wir es bei
anderen DichterInnen auch tun. Wir lesen ja auch die Gedichte Rimbauds nicht
bloß angesichts seiner Jugend.
[1] Ihr „Helicon bei Gristow“ kann sich nicht höher als 40 Meter erheben, denn Erhebungen über diese Höhe kommen in der Gegend nicht vor, ist also allenfalls für Norddeutsche überhaupt ein Hügel.
[2] http://www.wortblume.de/dichterinnen/feindfre.htm
[3] Das erinnert an andere kaltschnäuzige Gesten der Textgeschichte: Majakowskis „Ich sehe/ wie ein einst/ von hier/ Majakowski/ silbenweis’/ Worte/ zu Versen/ warf“, Dürers Geste, sich auf einem Heiligenbild selbst zu verewigen mit dem berühmten Zettel „Exegit quin- que mestri/ spatio Albertus/ Durer Germanus MDVI / AD“.
[4] Fretow.
[5] Für die Zeitgenossen wahrscheinlich weniger goutierbar als für Brechts lesenden Arbeiter.
[6] Wie heikel das ist, zeigt der Prosavorspruch, der schon, wäre auch kein weiterer Brief von ihr vorhanden, für sich allein beglaubigen könnte, was Hagen in seiner Leichenpredigt über sie sagt: „Sonst hat die offtgedachte Selige Jungfraw ... durch tägliche Abschreibung allerhandt Supplicationum vnd Missiven sich im stylisiren dermassen geübet / daß sie es manchem Advocaten vnd Cantzleyverwandten wol gleich thun / vnd selbst eine förmliche Missive vnd Supplication verfassen können.“
[7] Die mehrfache Ausnutzung eines Einfalls nach verschiedenen Richtungen ist dazu geeignet, einen Eindruck innerer Notwendigkeit zu erzeugen, auch das Wassermotiv wird kurze Zeit später wieder aufgenommen: „Dazu wan Fewersbrunst zum offtern mögt entstehn / So kan man also fort zu diesem Brunnen gehn.“
[8] Für diejenigen ohne Ortskenntnis: Die Gegend erhebt sich am flachen Bodden keinen Meter über den Wasserspiegel. Wenn in den Rinnen ein Boot unterwegs ist, sieht es erst aus der Nähe nicht mehr so aus, als führe es durch die Felder.
[9] Auch das „Trost=Getichte An unser Fretow“ zeigt ein höchst eigenständig erdachtes, wahrschein-lich persönlich grundiertes mythologisches Geschehen in teils handgreiflichen Bildern: „Mars zeigt sein rohtes Schwert / wil gleichfals mit mir streiten / Denckt nicht mehr an die Zeit / und an den lieben Tagk / Da er hier Waffenlooß mit Venus buhlen pflagk.“
[10] Neben der Flöte/ Pfeife ist die Schalmei ein zentrales Attribut der barocken Schäferei. Sie drückt im Gegensatz zur zarten gesitteten Flöte das ausgelassene, wilde, entgrenzende dieser Szenerien aus. „Die Liebe reimet sich so wenig mit Minerven, / Als eine Sterbe-Kunst zu Karten und zu Würffeln, / Das Braut-Bett in die Gruft, Schalmeyen zu der Orgel“ Gryphius: Ungereimtes Sonett; „Phyllis schickt Sylvanen Kräntze, / Alle Nymfen führen Täntze, / Ihre Furcht, der geile Pan, / Geht nicht minder stets im Reyen / Und auff seiner Wald-Schalmeyen / Singt er hievon was er kan.“ Dach, oder an anderer Stelle derselbe: „Er senckt' inß Graß die matten Glieder / Bey einer Silber-klahren Bach, / Vnd warff da Stab vnd Tasche nieder, / Sein Irden Trinck-geschirr zerbrach, / Verflucht' auch seine Wald-Schalmeyen / Vnd fieng erbärmblich an zu schreyen“ Oder bei Flemming: „Laßt uns tanzen, laßt uns springen, / denn die wollustvolle Heerde / tanzt zum Klange der Schalmeien / Hirt' und Heerde muß sich freuen, / wenn im Tanz' auf grüner Erde / Böck' und Lämmer lieblich ringen. (zum Dulcian: siehe unten).
[11] Sie hatten dem Überbringer der schlechten Nachricht unterstellen wollen, ein Lügner zu sein.
[12] Trotz dieser den Musen überlegenen Augenhöhe mit den Göttern, zeigt sich die Macht der Autorin gegenüber dem Text „Wieder die Feinde jhrer Fretowischen Fröhligkeit aber zurückgenommen. Verfügte sie dort noch über selbst denen der Götter offenbar überlegene Wirkmittel, nämlich ihre Feder, ist sie hier machtlos gegen deren Beschlüsse und kann nur punktuell eingreifen, das Geschehen ansonsten nur kommentierend begleiten. Das auf die Kraft ihrer Feder gebaute, dem Ort gegebene Versprechen der Ewigkeit hatte sie nicht einlösen können.
[13] „Der lange Weg zur Mündigkeit“ S.242 (Auch ihre Arbeit erwähne ich wegen ihres Einflusses, schließlich ist ihr Buch bis heute Pflichtlektüre zahlreicher germanistischer Seminare.)
[14] Bei polarisierenden Themen wie Krieg wird dies insofern merklicher, als uns bei einem weniger dringlichen Gegenstand oft das Engagement fehlt, uns ethisch-ästhetisch zu positionieren.
[15] Auff solchen frzeitigen Todtes=Fall / etc. Hochgedachten Herrn Alexander von Vor=buschen / Wohlbestalten Obristen / etc. der Kron Schweden.
[16] (Als H. M. A. C. so früzeitig mit Todt abgangen.) Man mag hier an Grimmelshausen denken und drückt dem Kind die Daumen, dass es an den Spieß tritt, weil die Soldaten lediglich zu faul sind, das Ding dauernd zu drehen … ein möglicher glimpflicher Ausgang für die Alten bedürfte wohl weitläufigerer Fantasie...
[17] Die Härte ihres lakonischen Realismus wird sichtbar, wenn man sich vergegenwärtigt, dass sie bei dieser Stelle sicherlich auch an sich selbst denken konnte.
[18] Hier wie das Vorige in militärischer Bedeutung, abgeleitet vom alten Wort „Stück“ für „Grobes Geschütz“ (Adelung), wie es in Worten wie Stückpforte, Feldstück (für deren hohe Anzahl und Schießfertigkeit der Bedienmannschaften besonders die Gustav Adolfsche Armee gefürchtet war) oder Stückgießerei (Kanonengießerei) auftaucht.
[19] 78 Anbind=Brieff. II E iij b.
[20] Eine Frage, die, solange die konkrete Tätigkeit nicht zum Unglück selbst beiträgt, letztlich immer mit „ja“ beantwortet werden sollte, insofern sonst gar nicht mehr klar ist, zu welchen Zwecken man die fragliche Katastrophe aufhalten sollte, wenn nicht um einer freien Entfaltung der menschlichen Möglichkeiten willen.
[21] Diese besondere Spannung zwischen dem Konkreten und der gelehrten Anspielung zieht sich durch viele Teile ihres Werkes. Wenn Daphne im Faunus Verse in einen Kürbis schneidet, mag man an Heinrich Alberts Kürbiszucht denken, in deren Früchte die Mitglieder des Königsberger Kreises sich solcherart einzuschreiben pflegten. Man kann aber auch mit praktischem Sinne denken, dass angesichts einer kurzen Wartezeit ein Kürbis einen praktikableren Schreibgrund abgibt als die sprichwörtliche Rinde.
[22] https://gedichte.xbib.de/Schwarz_gedicht_Auff+Jungfer+Judith+Tanckin+Namenstagk.htm
[23] Dass mythologische Motive aus der Bibel und der griechischen Antike zwanglos zusammengehen, ist ein Merkmal der säkularen Dichtung der Zeit.
[24] Auch einen Titel wie „pommersche Sappho“ oder „Sappho vom Weichselstrand“ erringt man erst mit einer greifbaren Leistung.
[25] Und es beschränkt sich nicht allein darauf. Weitere Winke (keiner an sich mag zwingend sein) wären etwa: Die Widmung an die Königin Christina von Schweden, die seinerzeit selbst als der sapphischen Liebe zugeneigt galt. Immerhin sind die lebenden Beteiligten am Zustandekommen der Ausgabe im Großen und Ganzen Untertanen des polnischen Königs, und selbst Sibylla Schwarz war nie förmlich Untertanin der schwedischen Krone, sondern ihre Heimat stand unter wechselnden Besatzungen, darunter auch unter schwedischer. Ein weiteres wären die Bemerkungen Gerlachs an Peter Vanselow in der Einleitung zu den Sonetten.
[26] Auch der Mythos vom nachts schreibenden, von Hausarbeit bedrückten Mädchens aus bescheidenen Verhältnissen erleichtert dieses Vorbeigehen. Wer in einer solchen Situation ist, hat plausibler Weise andere Sorgen, als die der Erfüllung der eigenen sexuellen Leidenschaft.
[27] Insgesamt dreimal bringt Sibylla Schwarz den Pan mit einem „groben Dulcian“ in Verbindung. Das Instrument taucht praktisch niemals wie hier solistisch in der älteren Lyrik auf. Überhaupt ist es sehr selten, und wenn, taucht es nur dann auf, wenn eine Fülle von Instrumenten bedeutet werden soll, so in drei Gedichten von Friedrich von Spee „Ihr Lauten/ Geigen/ Dulcian/ Ihr Cymbel/ harpff/ vnd fleuten / Posaun/ Cornet/ Trompeten klar“ „ Wer nach jhm wil nunmehr brauchen / Seine leyr/ vnd dulcian? Wer nach jhm so lieblich hauchen / Vnd die pfeifflein blasen an?“ „Wer soll haben seine Geigen? Cither/ Leyr/ vnd Dulcian?“, oder in der Arminbearbeitung des letzte Textes im Wunderhorn: „Wer soll haben seine Geigen, / Dulzian und Mandolin?“
Das Instrument gilt als lieblich (und hat seinen Namen daher). Seine Bauweise ist in keiner Weise grob, sondern für ein Holzblasinstrument der Zeit vergleichsweise kompliziert. (Ein metallener S- Bogen und die im 180 Grad Winkel geknickte Luftröhre verlangen große handwerkliche Fähigkeit.) Als musikalische Nebenbedeutung für „grob“ gibt Grimm für die Zeit des Barock: „von dunklerer farbe des tons, 'dumpf'“. Bei fahrenden Spielleuten ihrer Zeit war der Bassdulzian, (im Gegensatz etwa zu den tiefen Vertretern der Gambenfamilie), ein Vorläufer des Fagott, als handliches Bassinstrument beliebt.
[28] (Danach folgen nur noch die drei beschriebenen Chöre.)Wohlgemerkt: In der Regel scheint Pan keine Stellvertreterfigur der Autorin, sondern eine unabhängige Gestalt zu sein. Hier scheint die Lage anders, weil sowohl die Autoren-, als auch mögliche Vertreterfiguren wie die Musen im Text andere Aufgaben haben. (Offenbar ist das dort geschilderte Göttertreffen eher eine informelle Runde: Der für die Dichtkunst sonst zuständige Apoll ist gar nicht anwesend.)


