(Najem Wali:) 25 Jahre Writers in Exile
Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen
Barbara Zeizinger
Najem
Wali (Hrsg): 25 Jahre Writers in Exile. Gefährdete Stimmen einer Welt in Gefahr.
Anthologie. Berlin (Secession Verlag) 2025. 300 Seiten. 25,00 Euro. ISBN
978-3-96639-092-7
Ein Text lässt sich
nicht töten
»Schriftstellerinnen und Schriftsteller leisten Widerstand, setzen sich für Gerechtigkeit und freie Gesellschaften ein. Dafür werden viele von ihnen verfolgt, bedroht, angegriffen, eingekerkert, verbannt und nicht selten getötet. Solange eine oder einer von ihnen irgendwo nicht frei ist, ist niemand frei.«
Das
schreibt Najem Wali, Vizepräsident des PEN Deutschland und Herausgeber der
Anthologie »25 Jahre Writers in Exile. Gefährdete Stimmen einer Welt in
Gefahr.«
Um
diesen Stimmen dennoch Gehör zu verschaffen, unterstützt der PEN in seinem
Writers-in-Exile-Programm seit 1999 diese Autoren und Autorinnen. Mit Hilfe
einer Projektförderung durch die jeweiligen Bundesbeauftragten für Kultur und
Medien wird Betroffenen dabei geholfen, im deutschen Exil frei zu leben und zu
schreiben. Die vorliegende Anthologie feiert gleich zwei Jubiläen: 100 Jahre PEN-Zentrum
Deutschland sowie 25 Jahre Writers-in-Exile-Programm.
Die
Orte der Verfolgung sind weit über den Globus verstreut. Türkei, Sudan, Belarus,
Afghanistan, Iran, Irak, Kuba, um nur einige nennen. Ebenso vielfältig sind die
Themen, an denen Regierungen und sogenannte Sittenwächter Anstoß nehmen. Oft
ist es Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen, weswegen Dichter und
Dichterinnen verhaftet werden. Aber auch feministische Texte oder solche, die sich
mit Homosexualität befassen, können Anlass zur Verfolgung sein.
In
unterschiedlichen, teilweise sehr anrührenden, literarischen Texten erzählen
uns Lyriker, Erzähler, Blogger, Dramaturgen, Journalisten von ihrem Land und
den dort gemachten Erfahrungen. Von ihrer Ohnmacht, ihrem Ausgeliefertsein,
ihrer Verzweiflung und manchmal von Solidarität und von Glücksmomenten, trotz
alledem.
So
schreibt der türkische Schriftsteller Barbaros Altuğ: »Nicht wenn er erlebt,
ist der Mensch glücklich, sondern wenn er sich erinnert.« Dieser Satz könnte
für mehrere Texte als Überschrift gelten, besonders aber für »Secondhand-Zeit« der
Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch. Darin beschreibt sie die Entfremdung
einer russischen Mutter von ihrem Sohn. Denn während die Mutter immer wieder an
ihre nicht einfache sowjetische Vergangenheit denken muss, lebt der
materialistisch ausgerichtete Sohn in einer oberflächlichen Gegenwart: »Zwischen
uns liegt ein Abgrund, als wären Jahrhunderte vergangen.«
Die
Flucht vor lebensbedrohlicher Verfolgung geht oft einher mit der Trennung von
der Familie. Obwohl in Bangladesch die Säkularisation des Landes in der
Verfassung steht, geriet der Bibliothekar Zobaen Sondhi als Blogger in die
Fänge der Islamisten, da er sich in seinen Texten für Menschenrechte und
freiheitliches Denken einsetzte. In »Auf der Flucht vor der Machete« beschreibt
er, wie sich sein Leben veränderte. »Und so verließ ich mein zeitweiliges
Versteck in Indien und ging zurück nach Bangladesch, wo mich buchstäblich die
Todesangst packte – ich fürchtete von terroristischen Banden überfallen zu
werden.« Schließlich erhält er die Einladung für das Writers-in-Exile-Programm.
Es fällt ihm schwer, sich von seiner Frau und den Kindern zu trennen. Aber
letztlich schreibt er: »Ich muss für die Menschen um mich herum arbeiten, so
gut ich es vermag, und damit ich das kann, muss ich am Leben bleiben.«
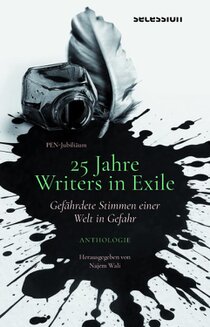
So
unterschiedlich die Autoren und Autorinnen in der Anthologie sind, so verschieden
sind die Texte. Da gibt es die hintergründige Geschichte des Ukrainers Alexei
Bobrovnikov »Monolog eines Bleistifts«, in dem er seinen Autor warnt, dass
Geschriebenes sich nie auslöschen lassen würde. »Und der Radiergummi
hinterlässt zu viele Spuren. / Man kann sich nicht reinwaschen. / Ein Text
lässt sich nicht töten. / Er bleibt in jedem Fall.«
Bùi
Thanh Hiếu aus Vietnam begegnet der Bedrohung mit Humor. »In Tagebuch einer
Ausreise. Das Verhör« beschreibt er, wie er den Ermittlungsbeamten raffiniert
an der Nase herumführt. »Ich krümmte mich vor Lachen«, schreibt er.
Gerne
würde ich noch aus vielen Texten zitieren, viele Autoren und Autorinnen genauer
vorstellen. Doch lesen Sie selbst. Nicht nur die Geschichten und Gedichte
zeigen uns, wie wertvoll das Writers-in-Exile-Programm ist. Zusätzlich zu den Geschichten
erhält der Leser durch die ausführlichen Biografien Informationen über die
Herkunftsländer.
Najem
Wali in einem Vorwort und der ehemalige Präsident des PEN-Zentrums Deutschland José
F.A. Oliver in einem Nachwort erweitern in ihren Essays die Thematik des Buches.
Exil als unendliche Geschichte, als eigentliche Verfasstheit jedes schreibenden
Menschen, Exil, für das es viele Sprachen gibt.
Lassen
Sie mich etwas hoffnungsvoll schließen. Mit Zeilen aus einem langen wunderschönen
Gedicht von Volha Hapeyeva aus Belarus:
kinder kommen vom strand zurücksie können noch nicht lesen oder schreibensie müssen alles in sich selbst tragenso wächst das gedächtnissie zappeln plaudern streiten tummeln sichund plötzlichnimmt eins die hand des anderenso einfach und natürlichwessen hand – spielt keine rolleeines freundes oder eines feindesdie sind noch nicht hierdie kommen später mit den buchstabenjetzt gibt es nur hier und jetztund das gefühl der hand, die auf dem weg zur hand istum zusammen zu seinwenn es gefährlich wird


