Werner Söllner: Knochenmusik
Alexandru Bulucz
„Wer sehr in Eile ist darf verschwinden vor der Zeit.“
Zu Werner Söllners Gedichtband Knochenmusik
Für M.V.
wetterberichte (1975), Mitteilungen eines Privatmannes (1978) und Eine Entwöhnung (1980) heißen Werner Söllners in Rumänien erschienene Gedichtbände, die unter anderem von Franz Hodjak lektoriert wurden. Mit diesem und mit Klaus Hensel und Richard Wagner hielt Söllner, der 1982 von einer Schriftstellertagung in Köln nicht mehr nach Rumänien zurückkehrte, die Frankfurter Poetik-Vorlesungen Das Fremde im Eigenen, das Eigene im Fremden: Erfahrungen mit der Muttersprache im doppelten Exil (1993). Zu diesem Zeitpunkt in Deutschland schon erschienen waren die viel und zu Recht gelobten Bände Kopfland. Passagen (1988) und Der Schlaf des Trommlers (1992). Weniger bekannt ist Söllners Zusammenarbeit mit Sascha Juritz, dessen Originalgraphiken seine unter dem Titel Das Land, das Leben (1984) gesammelten Gedichte begleiteten. Dass man hierzulande etwas vom Epitheton „rumänischer Majakowski“ (Mircea Dinescu) weiß, geht zurück auf seine glänzenden Übertragungen ins Deutsche.
Jetzt, nach mehr als 20 Jahren seit der letzten Buchveröffentlichung, erscheint Knochenmusik. Der kapitellose Band enthält 47 Gedichte, freirhythmische, reimlose und gereimte, die inhaltlich wie formell durchaus an die älteren anschließen, auch wenn der zeitliche Abstand zu besagter letzter Großveröffentlichung dies kaum vermuten lässt. Das rührt auch daher, weil Knochenmusik Gedichte aus den letzten 20 oder mehr Jahren zusammenbringt. Einige von ihnen sind im Archiv der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder vom Autor selbst auf lyrikline.org eingesprochen zu finden. Somit geht es bei Knochenmusik mehr um die Frage nach der Komposition des Bandes – auch vor dem Hintergrund von Söllners Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte, mit der er offen umgeht.
Eines ist sicher, da würgt jemand an seinen Verfehlungen. Dieses Würgen: ein persönliches, ein poetologisches. Das eine ist nicht ohne das andere zu denken. In der Juryerklärung zur SWR-Bestenliste November, auf der Knochenmusik Platz 5-6 belegt, heißt es zu Söllner vorsichtig: „Er begann mit dem Schreiben von Gedichten und Kinderbüchern in den Zeiten der Diktatur in Bukarest. Schuldlos kommt man da nicht heraus.“
Aber führt besagtes Würgen des Schuldigen (um in der Sprache der SWR-Jury zu verbleiben), führt Einsichtigkeit, führt die Tatsache, dass man sich zu den eigenen Fehlern bekennt, zur Lösung des Problems? Im Gedicht „unhymnische feststellungen“ aus wetterberichte lautet die letzte Strophe: „so wird die neue gesellschaft ihre probleme lösen: / indem sie sich / zu ihnen bekennt“.
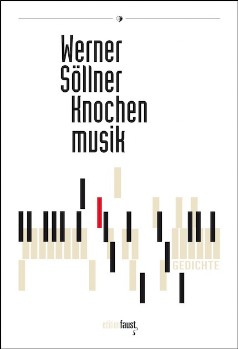
Ist das Ernst oder Ironie? Je nach Lesart muss man hier zwischen einem konstruktiven Lösungsvorschlag und einer dekonstruktiven Kritik an bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen unterscheiden. Was ist die Lösung des Problems, wenn sie nicht mehr vom Schuldigen abhängt? Vielleicht wäre das die Einsicht in die Beschaffenheit von Einsichtigkeit. Dann wären Söllners Gedichte der Schlüssel dazu, das Geheimnis, die Brücke: „Jeder Mensch hat / ein Geheimnis. // Für den einen / ist es ein Abgrund; wenn er / hineinschaut, stürzt er / zu Tode. Für den anderen ist es / eine Brücke über den Abgrund.“ („Jeder Mensch“) Vergebung auf einer Brücke über dem Abgrund: Das ist es vielleicht, was die Poesie lehrt.
Und verklären Begriffe wie „Schuld“ und „Schuldiger“ nicht auch die persönliche und familiäre Not des Menschen in der Diktatur, vor allem dann, wenn der „Schuldige“ nicht freiwillig und mit Enthusiasmus zu einem solchen geworden ist? Von Richard Wagner kein Wort dazu in seinem im Dezember 2009 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienenen Artikel „Bespitzelung bis in den letzten Vers“. In diesem Artikel deutet Wagner (unter anderem auch Literaturwissenschaftler), wenn er am Ende des Artikels aus Söllners Gedicht „Am Bodensee“ (ebenso im Schlaf des Trommlers abgedruckt) zitiert, eine rein (!) biographische Lesart des Gedichts an und missbraucht es somit aufs ordinärste. Das ganze Gedicht: „Kein Leck im Boot, / in der Haut kein Loch. / Die Freunde sind tot / oder sterben noch. // Wie es war und warum, / wen geht es was an? / Aufrecht oder krumm: / man geht, wie man kann. // Wovor dir graut: / was vergessen ist. / Ist die gerettete Haut / auch eine List?“
„Das Krumme vor jedem Geraden“ ist ein Gespräch betitelt, das Werner Hamacher 2012 mit zwei Ungarn geführt hat. Man kann sich sicher sein, dass es in keiner Diktatur jemals umgekehrt war. Nach der Verunmöglichung des aufrechten Gangs durch die Diktatur wird in Wagners Artikel nicht gefragt. „An einem Abend im Herbst / geh ich mit Czecho, der nicht zu den Siegern, der / zu den Überlebenden zählt (…) / (…) vertieft / ins Selbstgespräch der Geschichte“ (aus „Spaziergang“, einem Heinz Czechowski gewidmeten Gedicht).
Was in Knochenmusik aus diesen und anderen Sinnzusammenhängen übrigbleibt, ist ein sichtlich verletztes lyrisches Subjekt, das den Glauben an eine letzte Wahrheit verloren hat: „Richtig / oder falsch. Wer das entscheidet? Vielleicht / die Wespe, die grad im Zucker erstickt. Oder / der Stern, der auf uns zurast und nicht unterscheiden / kann zwischen unsrer Geschichte und unsren / Geschäften“ (aus „Besuch“). „Ist es meine Wahrheit, vor der / ich erschrecke, oder ist es / die Wahrheit der andern? Und welche / von beiden ist schlimmer?“ (Aus „Jede Nacht“). Und auch das Wunder bleibt übrig, dass man trotz Angst wieder Gedichte schreibt – ein Punkt, den Eva Demski in ihrem Nachwort berührt –: „In der Schublade ein paar Kilo / verstaubtes Papier, in gewissem Sinne / Gedichte, darunter die Angst“ (aus „Hinterlassenschaft“).
Der Gedichtband ist eine große poetische Abwägung eines lyrischen Ichs zwischen Dialog, Dialog-Verweigerung, Skepsis, Resignation und Isolation. In Martin Bubers Ich und Du wird das Ich „am Du zum Ich“, wobei diese Formulierung von der Herkunft von Du und Ich aus ihrer Mitte zeugt. Auch in Söllners Gedichten wird das Ich vom Du bedingt, nur kommt ersteres als Anhängsel des letzteren vor: „Ich, das an den anderen, den vielen“ (aus „Was war“). Mit der nächsten Zeile nimmt dieses Philosophem eine dramatische Wendung: „Ich, das an den anderen, den vielen / anderen Rollen zerbricht“. Daraus geht nicht selten ein unbeteiligter Beobachter hervor: „Ich dachte an das Wort / ich von außen“ (aus „An einem Tag im Oktober“). Dann wiederum wird das Ich als Begrenzung erfahren, als Enge: „Eingekesselt im Ich“ (aus „Korrigierter Entwurf“). „An so vielen Orten bin ich / schon ich gewesen, daß ich / nicht mehr weiß, wer ich bin. // (…) Ich kann / nicht mehr nur ich selbst / sein, mir ist so eng. // Deshalb schreibe ich dir / und den anderen.“ (Aus „Ich“) Es ist dieses widersprüchliche Begehren sowohl nach dem einen als auch nach dem anderen. In dieser inneren Zerrissenheit spielt sich Söllners Dichtung ab.
Angesprochene Verweigerung ist auch eine Selbstverweigerung: ein cioranesker Aspekt, der in Söllners Dichtung variiert wird. „Ohne die Idee des Selbstmords hätte ich mich schon längst getötet“, schreibt Cioran. In einem der schönsten Gedichte des Bandes heißt es bei Söllner dazu in fast aphoristischer Form: „Der Raum ist krumm / mehr als wir dachten. // Wer sehr in Eile ist / darf verschwinden / vor der Zeit.“ (Aus „Erschrecken, nachts“) In „Frankfurt am Morgen“: „Das Leben hat Geduld – / es läßt sich leben. // Nur ich hätt’ es gern anders.“ Eine alte engelhafte Frau, die „endlich sterben will“, wird wie folgt zitiert: „‚nichts‘, sagt / sie, ‚als sterben, ich weiß gar nicht, warum / das nicht geht‘“ (aus „Die Engel grüßen“). Wenn die Idee des Selbstmords das Leben erträglicher macht … Warum nicht daran denken? Auch erträglicher macht es die Sucht, die in kritischen Situationen wirksamer ist als alles andere. Es würde jedem auffallen, wenn in Söllners Gedichten kein Kaffee getrunken und keine Zigarette geraucht werden würde. Doch auch solche Sucht kann nicht über die Phasen der Hoffnungslosigkeit, der Gleichgültigkeit und des Nihilismus hinwegtäuschen: „Und ich sitze hier / und trinke Kaffee, greife gnadenlos / nach der Dose und kippe mir Zucker / in die Tasse, so daß die zwei / Wespen verrecken, unter der süßen Last, im Angesicht / eines gleichgültig kaffeetrinkenden Gottes.“ (Aus „Zwei Wespen, ach“) Und: „so beuge ich mich / vorläufig über ein Blatt, verliebt / in etwas, ohne Hoffnung / auf mehr“ (aus „Zweite Natur“).
Söllners Dichtung ist eine aufs Ganze gehende. Selbst das konkreteste Bild verweist auf etwas anderes als es selbst. Daher vielleicht die seltsam schöne Stimmung des Bandes. Immer wieder tauchen die Wörter „nie“, „immer“, „nichts“, „alles“ auf: „Es ist alles / gegessen schon vor dem Hunger, alles / gewußt, was keinen mehr angeht, bevor / es geschah // (…) Nichts ist unwiederholbar.“ (Aus „Korrigierter Entwurf“) „Mit lauter Stimme / hab ich erzählt. Von Angstlust / und Schuld, von Krieg und Schweigen / in mir. Vom Erbe. Von früher und nie. / Alles vielleicht.“ (Aus „Über den Dächern von Amsterdam“) Oder wenn Tinnitus als Sphärenmusik fast ekstatisch beschrieben wird: „Jetzt wußte ich, was / es war, dieses Rauschen. Es war / das Atmen aller Schlafenden dieser Welt, das / Stöhnen aller Liebenden und das Schreien / aller Gepeinigten. Alles zugleich / und auf einmal.“ (Aus „Tinnitus“) Im Liebesgedicht „Du sagst“ klingt das so: „Weißt du, alles, was ich / falsch gemacht habe, war falsch, / weil ich es richtig machen / wollte. Alles und immer / nur richtig.“
Diese Dichtweise wird dann zum Problem, wenn das Bild, das sie wählt, ihre Absichten zu durchschaubar macht. Ein einziges Gedicht fällt in diesem Sinne aus dem Rahmen des Bandes raus, und zwar das Gedicht „Quastenflosser“. Hier hat man den Eindruck, dass der Quastenflosser für einen bestimmten Daseinsmodus des Menschen symbolisch herhalten muss: „Auch sonst ist wenig bekannt über ihn.“ „Er erschrickt / nicht, wenn er beobachtet wird, aber er zieht es / vor, sich abseits zu halten.“ „Ein Beweis für die lebenserhaltende Macht / der Gewohnheit“.
Vielleicht ist Söllner der Dichter der schönen Gedichte. Verglichen mit den vielen der aktuell eingesetzten lyrischen Formen dürften seine als eher klassisch gelten. Seine Sprache ist wenig emphatisch und zurückhaltend, sie ist bilderreich, präzis und nicht verrätselt, so als sei diese Lyrikform die einzige, für die man in einer nicht unter Zensur leidenden Staatsform plädieren könnte. Aber man hat den Eindruck, durch die Wirkung dieser Sprache auf den Leser, durch das, was sie in einem auslöst, würden die Gedichte implodieren, so viel enthaltene Semantik schwebt insgeheim in ihrem Hintergrund mit. Jede Zeile ist für sich eine semantische Einheit, lücken- und ausnahmslos. Zu Recht schrieb Heinrich Detering einst vom Klangzauber der Dichtung Söllners. Söllner konnte das Hören in seinem nach zwei Semestern aufgegebenen Physikstudium schulen: „Und da habe ich exakt zwei Semester lang Physik studiert, weil ich Physik (…) ungeheuer faszinierend finde. (…) Und während der beiden Semester habe ich herausfinden müssen (…), dass zum Physikstudium auch stundenlange Aufenthalte im Phonetiklabor gehören, wo man Glasröhren reiben musste, damit die Sandfüllungen dieser Glasröhren Wellen nachbilden, damit wir die akustischen Wellen verstehen.“ (Söllner 2012 im Gespräch mit Bernd Leukert, dem Herausgeber der Reihe, in der Knochenmusik erscheint.) Anders lässt es sich kaum sagen: Söllners Dichtkunst grenzt an Perfektion.
Hinter der trügerischen Schönheit liegt Ernst, liegt Unverborgenheit, liegt Zweifel – und dann (mit einem Verweis auf Paul Celans Zeile „es sind / noch Lieder zu singen jenseits / der Menschen“, die Söllner umkehrt) auch so etwas wie Hoffnung: „Freiheit, wort- / los zu sein! // Als sei jenseits der Sprache / eine andere flüssige Welt.“ (Aus „Seestück“)
Wenn wir uns den Musikantenknochen stoßen, tut es weh. Der Schmerz strahlt bis in die Fingerspitzen, es kribbelt.
„Irgendwo, fast in / der Mitte, etwas, das / weh tut. Ich sollte weniger / rauchen. // Fast mein Innerstes, / Liebste, ist nach außen / gekehrt.“ (Aus „Meine Haut“) „Es ist jetzt ein Riß / in der Welt, von der Mitte / zum Rand. Laß uns gehen. Komm, / gib mir die Hand. Laß uns / aufs Königshaus pinkeln, mit / den Pferden. Und laß mich // raten, daß ich weiter // wüßte als bis / zur Bank.“ (aus „Swift Code“)
Werner Söllner: Knochenmusik. Gedichte. Mit einem Nachwort von Eva Demski. Frankfurt am Main (Edition Faust) 2015. 72 S. 18 Euro.
